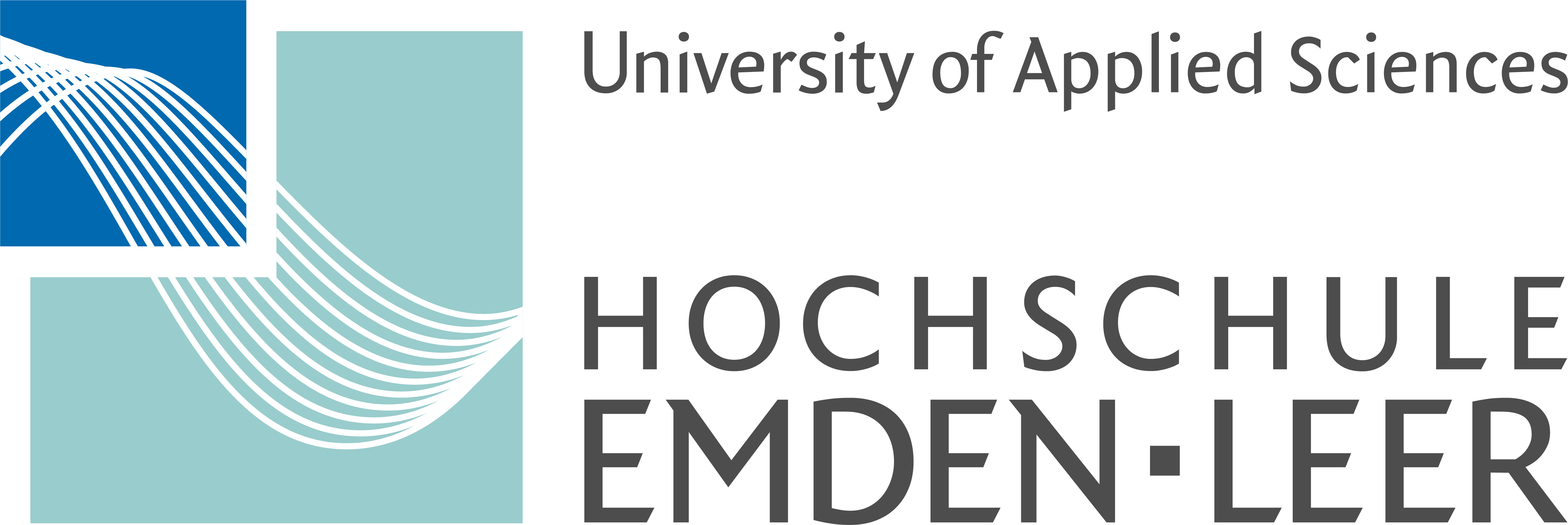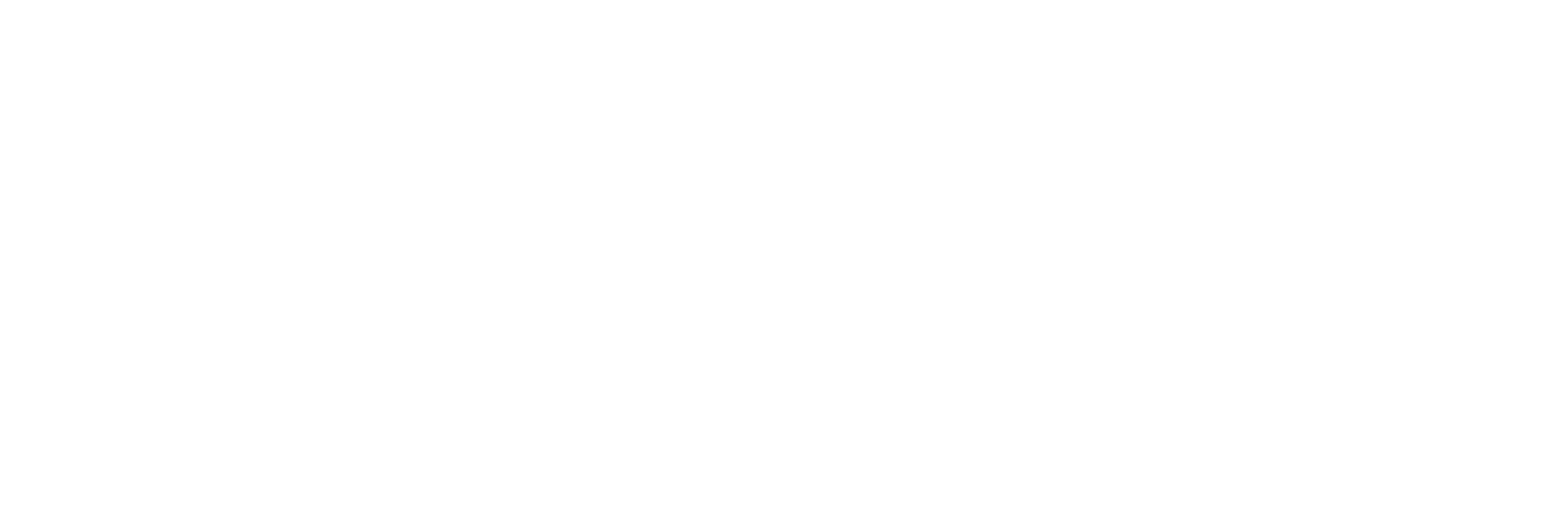-
Studieninteressierte
-
Studierende
-
Fachbereiche
-
Seefahrt und Maritime Wissenschaften
-
Soziale Arbeit und Gesundheit
- Blick in den Fachbereich
- Kontakt
- Erstsemesterinformationen
-
Internationales
-
Forschung
- Institute
- Gremien
-
Projekte
- COVID
- EBBiK - Entwicklung von Bildfähigkeit als Bildungsauftrag
- Familienzentrum Aurich (FamZ)
- Kombi-Nord
- Kommunale Suchtprävention in der Satdt Delmenhorst
- Kommunales Teilhabekonzept für die Stadt Emden
- REFU
- Sociotechnical Practices of Objectivation
- SoWeKi
- Suchtpräventionskonzept des Landes Niedersachsen
- Suchtprävention in Schulen (SiS)
- Wer nicht fragt, geht offline: Kids as digital citizens
- Werkstatt für Praxisforschung
- WOGO
- WOGE
-
Team und Termine
- Hilfen zum Studium
- Praxisreferat
-
Studiengänge
-
Technik
- Aktuelles
- Kontakt
- Studieren
- Forschung
-
Projekte
-
Labore im Fachbereich Technik
- Additive Fertigung
- Denkraum
- Designlabor
- FabLab - Labor für studentische Projekte
- Automatisierungssysteme
- Bioverfahrenstechnik
- Biochemie/Molekulare Genetik
- Innovationen im Ingenieurwesen
- Instrumentelle Analytik
- Intelligente Produktionssysteme
- Kolbenmaschinen
- Maschinendynamik
- Leichtbaulabor
- Maschinenelemente
- Mechatronik
- Mikrobiologie
- Organische Chemie/Nachwachsende Rohstoffe
- Physikalische Chemie
- Polymere
- Produktionsplanung
- Produktionstechnik
- Rechnernetze
- Regelungstechnik
- Labor S4
- Technische Informatik
- Verfahrenstechnik
- Werkstoffkunde, Laser- und Fügetechnik
- Wind - und Solarenergie
- Zellkulturtechnik
- Labor IT-Sicherheit
- Forschung / Institute
- Unser Fachbereich
-
Studiengänge
- Applied Life Sciences
- Biotechnologie
- Biotechnologie im Praxisverbund
- Business Intelligence and Data Analytics (Master)
- Chemietechnik/Umwelttechnik
- Chemietechnik im Praxisverbund
- Elektrotechnik
- Elektrotechnik im Praxisverbund
- Engineering Physics
- Engineering Physics (Master)
- Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
- Industrial Informatics (Master)
- Informatik
- Informatik im Praxisverbund
- Maschinenbau und Design
- Maschinenbau und Design im Praxisverbund
- Maschinenbau (Master)
- Medieninformatik (Online)
- Medieninformatik (Online, Master)
- Medientechnik
- Nachhaltige Produktentwicklung im Maschinenbau
- Nachhaltige Prozesstechnologie
- Nachhaltige Prozesstechnologie (PV)
- Wirtschaftsinformatik (Online)
- Regenerative Energien (Online)
- Technical Management (Master)
- Technology of Circular Economy (Master)
- Internationaler Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
- Wirtschaftsingenieurwesen – Engineering & Management
-
Wirtschaft
- Modulhandbücher, Ordnungen & Vorleistungen
- Aktuelles, Termine & Informationen zum WiSe 2025/2026
- Projekte & Forschung
-
Studiengänge
- Business Management (M. A.)
- Energy & Sustainability Management (B. Sc.)
- Digital Management (B. Sc.)
- Business Management - BWL (B. A.)
- International Business & Culture (B. A.)
- Betriebswirtschaft dual (B.A.)
- Betriebswirtschaft (B. A.)
- Wirtschaftspsychologie (B. A.)
- International Business Administration (B. A.)
- Advanced Management berufsbegleitend (M. Sc.)
- Advanced Management Stipendium
- Management Consulting (M. A.)
- Wirtschaftsinformatik Online (M. Sc.)
- Das Team vom FB Wirtschaft
- Erstsemester & Studieninteressierte
- Absolvierende & Alumni
-
Auslandsbüro
- Im Studium
- Informationen für Schulen
-
Seefahrt und Maritime Wissenschaften
- Studium
- Service-Einrichtungen
- Beratung für Studierende
-
Campusleben
-
Fachbereiche
-
QuickLinks
-
Hochschule
- Für Unternehmen
-
Zentrum für Weiterbildung
- Übersicht
-
Weiterbildungen
- Burnout-Prophylaxe
- Cybercrime
- Gamification für Businesstransformation
- Business Basics for School
- Sustain 2030
- Lean Management
- „Nordbeat–der Norden macht Zukunft:Tag der Weiterbildung
- Business 2 Business - 5.0
- Betrieblicher Gesundheitsmanager in BPS
- Programmieren mit Scratch
- Cyber-Security Hacking Training
- Konfiguration mit Sidekick -Humanisierung der KI
- Kommunikation, Wertschätzung und Selbstmanagement
- Konflikt-Kommunikation
- Kommunikation und Gesprächsführung:Konflikt-Kommunikation
- Kommunikation & Zusammenarbeit
- Humor in der Beratung
- Kundenzentrierung-Customer Centricity für KMU & Start-UP
- Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Gewaltfreie Kommunikation
- Casemanagement im Praxisalltag
- Trauma-Pädagogik
- Reflexionstag
- Outdoor-Erlebnis
- Finance for non-finance
- Management-Essentials: Gamification für BWL-Einsteigende
- Marketing Praxiswerkstatt
- Software Development
- Nachhaltige Führungskräfteentwicklung
- Agile Frameworks I
- Einführung in die Produktionstechnologie
- Traumaberatung
- Systemische Beratung und Coaching
- Windenergie-Nutzung
- Region im Fokus
- Presse
-
Organisation
-
Einrichtungen A-Z
- Arbeitssicherheit
-
Bibliothek
-
CampusDidaktik
- Team CampusDidaktik
- Tag der Lehre
- Q&A
- Positionspapiere
- Tools für Lehre und Zusammenarbeit
- Moodle
- Impulse und Inspiration für die Lehre
- Kleingruppenarbeit begleiten
- Urheberrecht in der Lehre
- KI in der Hochschullehre
- Hybride Lehre
- Barrierefreiheit in der Lehre
- Planspielzentrum
- Digitale Prüfungen
- Institut für projektorientierte Lehre (Ipro-L)
- Didaktische Beratung
- Career Service
- Datenschutz
- Finanzabteilung
- Gebäudemanagement
-
Gleichstellungsstelle
- Hochschulplanung und Qualitätssicherung
- health & sports
-
Immatrikulations- und Prüfungsamt
-
International Office
- Kommunikation und Hochschulkultur
- MeerCommunity Startup Center
- Nachhaltigkeit
- Ombudswesen
-
Personalabteilung
- Personalrat
- Präsidialbüro/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Rechenzentrum
- Sprachenzentrum
- Studium Generale
- MyCampus
- ver.di Betriebsgruppe
-
Wissens- und Technologietransfer
- Zentrale Studienberatung
- Zentrum für Weiterbildung
- Karriere
- Präsidium
- Veranstaltungen
- Leitbild
- Organigramm
- Zahlen, Daten und Fakten
-
Ordnungen, Richtlinien, Verkündungsblätter
- Ordnungen und Richtlinien
-
Ordnungen für Studiengänge
- Advanced Management
- Applied Life Sciences
- Betriebswirtschaft
- Betriebswirtschaft (dual)
- Biotechnologie/Bioinformatik
- Biotechnologie
- Biotechnologie im Praxisverbund
- Business Administration (dual)
- Business Intelligence and Data Analytics
- Business Management
- Business Management (Bachelor)
- Chemietechnik/Umwelttechnik
- Chemietechnik im Praxisverbund
- Digital Management
- Elektrotechnik
- Elektrotechnik im Praxisverbund
- Elektrotechnik und Automatisierungstechnik
- Energieeffizienz
- Energy and Sustainability Management
- Engineering Physics (Bachelor)
- Engineering Physics im Praxisverbund
- Engineering Physics (Master)
- Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
- Industrial Informatics
- Informatik
- Informatik im Praxisverbund
- Inklusive Frühpädagogik
- Interdisziplinäre Physiotherapie/Motologie/Ergotherapie
- International Business Administration
- Internationaler Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (IBS)
- International Business and Culture
- Kindheitspädagogik
- Lasertechnik
- Management Consulting
- Maritime Operations
- Maritime Technology and Shipping Management
- Maschinenbau
- Maschinenbau und Design
- Maschinenbau und Design für Berufsqualifizierte
- Maschinenbau und Design im Praxisverbund
- Medientechnik
- Nachhaltige Produktentwicklung im Maschinenbau
- Nachhaltige Prozesstechnologie
- Nachhaltige Prozesstechnologie im Praxisverbund
- Nautik
- Nautik und Seeverkehr
- Online-Bachelorstudiengang Medieninformatik (Voll-/Teilzeit)
- Online-Masterstudiengang Medieninformatik (Voll-/Teilzeit)
- Online-Bachelorstudiengang Regenerative Energien
- Online-Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (Voll-/Teilzeit)
- Online-Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik
- Physiotherapie
- Schiffs- und Reedereimanagement
- Soziale Arbeit
- Soziale Arbeit (BASA-online)
- Soziale Arbeit und Gesundheit im Kontext sozialer Kohäsion (Vollzeit/Teilzeit)
- Soziale Kohäsion im Kontext Sozialer Arbeit u. Gesundheit
- Sozial- und Gesundheitsmanagement
- Sozialmanagement
- Sustainable Energy Systems
- Technical Management
- Technology of Circular Economy
- Wirtschaftsinformatik (Dual)
- Wirtschaftsingenieurwesen Maritime Wissenschaften (B.Sc.)
- Wirtschaftsingenieurwesen - Engineering & Management
- Wirtschaftspsychologie
- Verkündungsblätter
- Gremien
- Beauftragte
- Hochschulwahlen
-
Einrichtungen A-Z
- Studienorte
-
Forschung
-
Forschungsprofil
- Forschungs- und Transferstrategie
- Forschungsschwerpunkte
-
Forschende
- Seefahrt und Maritime Wissenschaften
- Soziale Arbeit und Gesundheit
-
Wirtschaft
- Prof. Dr. Knut Henkel
- Prof. Dr. Tom Koch
- Prof Dr. Ute Gündling
- Prof Dr. Annika Wolf
- Prof. Dr. Jan Handzlik
- Prof. Dr. Hans-Gert Vogel
- Prof. Dr. Till Becker
- Prof. Dr. Henning Hummels
- Prof. Dr. Thomas Lenz
- Prof. Dr. Wolfgang Portisch
- Prof. Dr. Jan Christopher Pries
- Prof. Dr. Ute Rademacher
- Prof. Dr. Marco Rimkus
- Prof. Dr. Eva-Maria Schön
- Prof. Dr. Joachim Schwarz
- Technik - Elektrotechnik + Informatik
- Technik - Maschinenbau
-
Technik - Naturwissenschaftliche Technik
- Prof. Dr. Gerhard Illing
- Prof. Dr. Gottfried Walker
- Prof. Dr. Ingo de Vries
- Prof. Dr. Mark Rüsch gen. Klaas
- Prof. Dr. Jens Hüppmeier
- Prof. Dr. Iván Herráez
- Prof. Dr. Ralf Habermann
- Dr. Julia Jessica Reimer
- Prof. Dr. Claudia Gallert
- Prof. Dr.-Ing. Philipp Huke
- Prof. Dr. Martin Silies
- Prof. Dr. Martin Sohn
- Prof. Dr. Sven Steinigeweg
- Prof. Dr. habil. Ulrich Teubner
- Folgeabschätzung und Ethik
-
Projekte
-
Aktuelle Forschungsprojekte
- Applied Sustainable Transformation by Regional Anchors
- Adaptive Fortbildungen in der medienpädagogischen Altenbi
- AnkerPROF
- BUFFER+
- EARLY
- Entwicklung eines Reinigungsroboters für Offshore-WKA
- ExStyrol
- FlettnerFLEET
- GE-VORS
- Hyper4Rail
- INDUZELL
- InnoWerft
- Integrierte und innovative maritime Technologien für Mobi
- ISE-FiT Nordwerst
- MIINTER
- MeerCommunity
- NESSIE
- Nordwest Niedersachsen Nachhaltig Neu (4N)
- PANTHER
- ProlOg
- ReqET
- SIoT-Gateway
- SoGeWi
- SoWeKi
- StaKiNd
- Standardisierung, Weiterentwicklung und Kommunikation von
- Transferzentrum für Nachhaltige Mobilität
- TwinMaP
- VOLAP
- Wind & Regio
- W4S - Wind4Shipping
- WaddenVision
- KUNO
- Projekte nach Bereichen
- Beendete Projekte
-
Aktuelle Forschungsprojekte
-
Forschungseinrichtungen
- Promotionskollegien
-
Institute
-
Netzwerke
- Nationalpark Wattenmeer
- Promotionsnetzwerk Emden/Leer
- Digital Hub Ostfriesland (DHO)
- Tötungshandlungen in Einrichtungen des Gesundheitswesens
- Wachstumsregion Emsachse
- Maritimes Kompetenzzentrum (Mariko)
- greentech Ostfriesland
- NorShiP-Research School
- Association of Schools of Public Health
- Hochschulen für Gesundheit
- Deutsche Gesellschaft für Public Health
- Powerhouse Nord
- GENDERnet
- Einrichtungen in den Fachbereichen
-
Beratung
-
Forschungsprofil
„To Huus in Schuss – Gesund arbeiten im Homeoffice“
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hochschulangehörige, liebe Studierende,
es erwarten Sie aktivierende Beiträge rund um das Arbeiten im Homeoffice!
Spannende Vorträgeund vielfältige Angebote mit…
...Gastreferent*innen der Hochschule Emden/Leer
...Expert*innen der Techniker Krankenkasse und
...den Studierenden des Masterstudiengangs „Soziale Arbeit und Gesundheit im Kontext Sozialer Kohäsion"
am Mittwoch, den 16. Dezember 2020 von 17 bis 19 Uhr
als Webinar über die Online-Plattform BigBlueButton
und dem Zugang über Moodle 20W [MSK07.3.2] To Huus in Schuss - Gesund arbeiten im Homeoffice
Die Anmeldung erfolgt über die Selbsteinschreibung in den Moodle-Kursraum https://moodle.hs-emden-leer.de/moodle/course/view.php?id=6365. Der BigBlueButton-Raum für das Webinar wird am Veranstaltungstag ab 16.45 Uhr für Sie geöffnet sein.
Im Anhang finden Sie unseren Flyer mit dem Programmablauf des Webinars.
Das Webinar gehört zum Angebot der 2009 gegründeten Selbsthilfe- und Patientenakademie (SPA), einem Institut der Hochschule Emden/Leer. Weitere Informationen unter: https://www.hs-emden-leer.de/studierende/fachbereiche/soziale-arbeit-und-gesundheit/institute/selbsthilfe-und-patientenakademie-spa Hier kann auch das Jahresangebot der Selbsthilfe- und Patientenakademie (SPA) eingesehen und heruntergeladen werden.
Wir würden uns freuen, Sie am 16.12.2020 begrüßen zu dürfen.
Nehmen Sie teil und werden mit uns gemeinsam aktiv!
Ihr Veranstaltungsteam von "To Huus in Schuss" - Die Studierenden des Masterstudiengangs "Soziale Arbeit und Gesundheit im Kontext Sozialer Kohäsion an der Hochschule Emden/Leer"
und
Prof. Dr. Knut Tielking
Sprecher der SPA
Auskunft und Ansprechpartner der SPA an der Hochschule Emden/Leer:
Prof. Dr. Knut Tielking
Das Krankheitsbild Osteoporose – Was steckt hinter der dem Begriff
Die Nightline - Ein niedrigschwelliges Hilfsangebot von Studierenden für Studierende
Natur und Gesundheit - Können Naturerfahrungen einen Beitrag zur Gesundheitserhaltung leisten?
Resilienz bei Kindern psychisch kranker Eltern
Resilienz? - Zur Bedeutung im Kindesalter
Stress in der Arbeitswelt vermeiden – Aufgabe der Leitung?
Gesundheit im Strafvollzug
Demenz - was steckt hinter dem Begriff?
Problemstellung des Hausärztmangels in Niedersachsen
Soziale Ungleichheit im Gesundheitssystem
Constanze Weicher, Master Soziale Arbeit und Gesundheit im Kontext Sozialer Kohäsion, HS Emden/Leer
Viele Studienergebnisse, wie zuletzt die der „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ (DEGS) des Robert Koch Instituts (RKI), weisen darauf hin, dass sich der Gesundheitszustand von Menschen unterschiedlicher Bildungs- und Einkommensschichten zum Teil gravierend unterscheidet. Der aktuelle wissenschaftliche Stand zeigt, dass im deutschen Gesundheitssystem eine deutliche soziale Ungleichheit besteht. (Lampert et al. 2013, S. 816) Ärmere Menschen leiden zum Beispiel häufiger an Herz-Kreislauferkrankungen oder Burnout und sterben statistisch gesehen früher (Mielck 2008, S.21). Des Weiteren schätzen Menschen mit einem niedrigeren sozialen Status ihren allgemeinen Gesundheitszustand schlechter ein und weisen mehr gesundheitsbedingte Probleme und Risikofaktoren auf (Lampert et al. 2013, S.814). Menschen der oberen Schichten haben oft mehr Wissen bzgl. eines positiven Gesundheitsverhaltens und wenden dies z.B. in den Bereichen gesunde Ernährung, Sport, Bewegung und Prävention häufiger an. Personen der unteren Gesellschaftsschichten werden von gesundheitsrelevanten Informationen oft nicht erreicht. Grund dafür sind unterschiedlichste soziokulturelle Barrieren wie z.B. das soziale Umfeld. (Arnold 2011, S.17ff) Ferner lässt sich sagen, dass erwerbstätige Menschen häufig gesünder, sportlicher und seltener depressiv sind als erwerbslose Personen. Sie sind seltener übergewichtig und rauchen seltener. Genau so verhält es sich zwischen Gering - und Vielverdienern sowie zwischen Menschen mit einem hohen Schulabschluss und Menschen mit geringer Ausbildung. (Karrlsson, Okoampah 2014, S.79)
Die genauen Zusammenhänge sind noch nicht geklärt. Entsteht ein schlechterer Gesundheitszustand aufgrund von Armut, mangelnder Bildung und Erwerbslosigkeit oder bedingt es sich anders herum? Sinken durch einen schlechten Gesundheitszustand die Chancen auf gute Bildung und ein hohes Einkommen? Es scheint, dass die Ungleichheiten in unserem Gesundheitssystem ein vielschichtiges Problem sind. Politik und Gesellschaft müssen hier an vielen Stellen ansetzen um gesundheitliche Ungleichheiten abzubauen. Neben dem kritischen Hinterfragen der Zwei-Klassen-Medizin sind auch die Unterstützung und Förderung von präventiven Maßnahmen, Bildung und sozialen Sicherungssystemen wichtige Ansatzpunkte.
Literatur:
Arnold, N. (2011): Einleitung: Vielfalt und Selbstbestimmung im Gesundheitssystem – Wege aus der sozialen Ungleichheit. In: Wippermann, C.; Arnold, N.; Möller-Slawinski, H.; Bochard, M.; Marx, P.: Chancengerechtigkeit im Gesundheitssystem. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Karlsson, M.; Okoampah, S. (2014): Zum Zusammenhang von Armut und Gesundheit. In Frech, S.; Groh-Samberg, O. Armut in Wohlstandsgesellschaften (S. 79-106). Schwalbach: Wochenschau Verlag
Lampert, T.; Kroll, L.E.; von der Lippe, E.; Müters, S.; Stolzenberg, H. (2013): in Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz. H. 56, S.814-821
Mielck, A. (2008): Zum Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und gesundheitlicher Versorgung. In: Tiesmeyer, K.; Brause, M.; Lierse, M.; Lukas-Nülle, M.; Hehlmann, T. (Hrsg.): Der Blinde Fleck - Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung. Bern: Verlang Hans Huber. S. 21-38
Die Pille und ihre Beliebtheit
Ulrike Beckmann, 2019, HS Emden-Leer
Die sogenannte „Pille“ zur Verhütung erfreut sich großer Beliebtheit, obwohl es momentan auch viele negative Schlagzeilen zu diesem Verhütungsmittel gibt. Beispiele hierfür sind „Macht die Anti-Baby-Pille depressiv?“ vom MDR im Januar 2019 (vgl. Jakobi 2019, o. S.) und „Warnung im Beipackzettel: Die Pille erhöht das Suizidrisiko“ vom BR ebenfalls im Januar 2019 (vgl. Bräse 2019, o. S.). In einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gaben dennoch 55% aller Befragten an, mit der Pille zu verhüten (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 2003, S. 10). Eine Studie aus Nürnberg aus dem Jahr 2018 zeigt, dass 86% der 14 bis 19jährigen Mädchen mit der kombinierten Pille verhüten (vgl. Oppelt et al. 2018, S. 1001). Das wirft die Frage auf, warum dieses Verhütungsmittel gerade bei jungen Mädchen und Frauen so beliebt ist.
Zunächst wird dafür ein Blick auf die „Pille“ an sich geworfen. Die Antibabypille, wie sie auch genannt wird, gehört zu den hormonellen oralen Kontrazeptiva (vgl. Siekmann 2016, S. 44). Es gibt verschiedene Formen. Unterscheiden lässt sich hierbei in reine Gestagenpräparate, Östrogen-Gestagen-Kombinationspräparate und Östrogen-Gestagen-Sequenzpräparate. Diese unterscheiden sich im Teil des Zyklus, in dem zu dem gleichbleibend gegebenen Östrogen noch Gestagene gegeben werden, wie hoch die Dosierung dieses ist und ob die Dosierung im Verlauf noch ansteigt. Allen aber ist gemeinsam, dass sie die Hormonausschüttung aus der Hypophyse hemmen, wodurch der Eisprung verhindert wird (vgl. ebd. S. 47). Generell sind diese Verhütungsmittel verschreibungspflichtig und müssen täglich eingenommen werden - bestimmte Formen auch täglich um die gleiche Uhrzeit (vgl. ebd. S. 48).
Um die Sicherheit von Kontrazeptiva zu bestimmen, wird der sogenannte Pearl-Index benutzt. Er beschreibt die Anzahl der ungewollten Schwangerschaften bei optimalem Verwenden eines Verhütungsmittels innerhalb eines Jahres. (vgl. Stier et al. 2018, S. 114) Bei den Variationen der Pille liegt dieser Index zwischen 0,03 und 1,14 und ist damit ein vergleichsweise sicheres Verhütungsmittel (vgl. Siekmann 2016, S. 48).
Weitere Vorteile der Pille können positive Auswirkungen und/oder Verbesserungen von Blutungsstörungen, Menstruationsbeschwerden, prämenstruellem Syndrom, Akne, Hirsutismus1, PCO-Syndrom2und Endometriose3sein. Außerdem senkt sich langfristig die Rate für Darmkrebs und Ovarial- und Endometriumkarzinomen (vgl. Stier et al. 2018, S. 114).
Nebenwirkungen können hingegen Gerinnungsstimulierung, Erhöhung des Thrombose-Risikos, Blutdruckerhöhung und Beeinflussung des Lipidstoffwechsels sein. Durch Übergewicht und Rauchen können weitere Risiken auftreten. Außerdem wird die Sicherheit der Pille durch Einnahmefehler wie
Überschreiten des Einnahmeabstandes, parallele Einnahme bestimmter Medikamente, Durchfall oder Erbrechen stark beeinflusst – die Wirkung wird gemindert. (vgl. Stier et al. 2018, S. 114f.)
Ein weiterer Punkt, der seit noch nicht allzu langer Zeit in Bezug auf die Pille diskutiert wird, sind die Auswirkungen auf Psyche und Partnerwahl. Feststeht, dass sich Frauen hormonell bedingt eher Partner suchen, die für sie genetisch am besten geeignet sind. Da die Hormone ja durch die Pille beeinflusst werden, können sich diese Verhaltensmuster auch ändern, aber wissenschaftlich belegt ist das noch nicht. (vgl. Franz 2018, S. 30f.) Des Weiteren wurde kürzlich ein Schreiben vom Bundesinstitut für Arzneimittel veröffentlicht, in dem es um den Zusammenhang von hormonellen Verhütungsmitteln und Depressionen geht. Depressionen oder depressive Verstimmungen werden hier als bekannte Nebenwirkung dieser Kontrazeptiva beschrieben. Diese Nebenwirkungen sind wiederum ein Risikofaktor von Suizidalität. Deshalb soll Suizidalität nun als mögliche Nebenwirkung im Beipackzettel aufgenommen werden. Frauen mit Stimmungsschwankungen und/oder depressiven Symptomen sollen sich direkt mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin in Verbindung setzen. (vgl. Bundesinstitut für Arzneimittel 2019, S. 1f.) Hintergrund für dieses Dokument ist eine dänische Studie, die zeigte, dass Frauen, die hormonell verhüten, ein doppelt so hohes Risiko für Suizidversuche haben. Ob diese Verhütungsmittel wirklich ursächlich dafür sind oder nicht, wurde jedoch nicht festgestellt. (vgl. Wessel Skovlund et al. 2017, S. 1) 54% der Befragten der Studie der BZgA wurde ihre Verhütungsmethode von ihrem Arzt bzw. der Ärztin empfohlen (vgl. BZgA 2003, S. 18). Für sämtliche Verhütungsmethoden gilt, dass vor der Verschreibung durch den Gynäkologen oder die Gynäkologin eine ausführliche Beratung stattgefunden haben muss (vgl. Franz 2018, S. 28). Gerade über das Thrombose-Risiko sollte aufgeklärt werden. Hierfür gibt es z.B. von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe Aufklärungsbögen, die den Patientinnen mitgegeben werden können. (Neulen 2015) Durch die Änderungen im Beipackzettel wird dann in Zukunft auch mehr über die möglichen psychischen Folgen aufgeklärt. Ob die reine Information darüber im Beipackzettel ausreicht, bleibt fraglich. Ein gutes Beratungsgespräch beim Arzt sollte Standard sein und auch die Nebenwirkungen nicht außer Acht lassen. Die aktuelle eher negative Berichterstattung (siehe oben) führt außerdem dazu, dass mehr Frauen hormonelle Verhütungsmittel hinterfragen und mehr über Wirkungsweise und/oder Nachteile dieses Arzneimittels wissen möchten.
1 verstärkte Körperbehaarung bei Frauen (vgl. Schöller 2019, o.S.)
2 Häufige Hormonerkrankung bei Frauen (vgl. Schöller 2019, o.S.)
3 Vorkommen von gebärmutterschleimhautähnlichem Gewebe außerhalb der Gebärmutter (vgl. Schöller 2019,o.S.)
Literatur
Bräse, Veronika (2019): Warnung im Beipackzettel: Die Pille erhöht das Suizidrisiko. Hg. v. Bayrischer Rundfunk. Online verfügbar unter www.br.de/nachrichten/wissen/warnung-im-beipackzettel-die-pille-erhoeht-das-suizidrisiko,RFsrpFC, zuletzt abgerufen am 28.01.2019.
Bundesinstitut für Arzneimittel (Hg.): Hormonelle Kontrazeptiva: Neuer Warnhinweis zu Suizidalität als mögliche Folge einer Depression unter der Anwendung hormoneller Kontrazeptiva. Wichtige Arzneimittel-Information. Online verfügbar unter
www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz/DE/RHB/2019/rhb-hormonelle-kontrazeptiva.pdf, zuletzt abgerufen am 28.01.2019.
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (2003): Verhütungsverhalten Erwachsener 2003. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung 20- bis 44-jähriger, S. 3–29.
Franz, Maximilian (2018): Für (fast) jede Frau die passende Verhütung. In: gynäkologie + geburtshilfe 23 (5), S. 28–33. DOI: 10.1007/s15013-018-1510-2.
Jakobi, Lydia (2019): Macht die Anti-Baby-Pille depressiv? Hg. v. MDR aktuell. Online verfügbar unter www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/antibabypille-verhuetung-depression-nebenwirkungen-hormone-100.html, zuletzt abgerufen am 28.01.2019.
Neulen, Joseph (2015): Was bei der Verordnung der Pille zu beachten ist. Mehr Thrombosen unter neueren Gestagenen? In: gynäkologie + geburtshilfe (20), S. 44–45.
Oppelt, Patricia G.; Fahlbusch, Christine; Heusinger, Katharina; Lotz, Laura; Dittrich, Ralf; Baier, Friederike (2018): Situation of Adolescent Contraceptive Use in Germany. In: Geburtshilfe und Frauenheilkunde 78 (10), S. 999–1007. DOI: 10.1055/a-0684-9838.
Schöller, Dorit: Endometriose. Hg. v. Pschyrembel Online. Online verfügbar unter www.pschyrembel.de/Endometriose/K06TL, zuletzt abgerufen am 30.01.2019.
Siekmann, Tabea (2016): Sexualerziehung und gesundheitliche Aufklärung für Mädchen und junge Frauen. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Stier, Bernhard; Weissenrieder, Nikolaus; Schwab, Karl Otfried (2018): Jugendmedizin. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Wessel Skovlund, Charlotte; Steinrud Mørch, Lina; Vedel Kessing, Lars; Lange, Theis; Lidegaard, Øjvind (2017): Association of Hormonal Contraception With Suicide Attempts and Suicides. Hg. v. The American Journal of Psychiatry. Online verfügbar unter doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.17060616, zuletzt abgerufen am 28.01.2019.
Körperliche Aktivität als Bewältigungsansatz bei Depressionen
Geschrieben von Jana Luisa Gebken, Studentin im Master „Soziale Arbeit und Gesundheit im Kontext soziale Kohäsion“, 3. Semester an der Hochschule Emden / Leer.
Die Anzahl der Menschen, die an einer Depression leiden, steigt jährlich rasant an. Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren im Jahr 2015 ca. 322 Millionen Menschen betroffen, das entspricht 4,4 % der Weltbevölkerung.[1] Depression gilt als häufigste psychische Störung gefolgt von Alkoholismus, Angststörungen und Demenz.[2] Gerhardt Ruf definiert den Begriff der „Depression“ wie folgt: „Unter „Depression“ (…) wird in unserer Gesellschaft eine Störung der Affekte mit einer niedergedrückten Stimmungslage verstanden.“[3] Bei der klinischen Depression, auch depressive Störung genannt, bleiben eine Vielzahl der Symptome über längere Zeit hin stabil.[4] Die Merkmale einer klinischen Depression lassen sich in die vier Kategorien (Stimmung, Kognition, Verhalten und somatisch (körperlich)) einteilen.[5] Diese Form kann weder durch Anstrengung noch mit Willenskraft kontrolliert werden und beeinflusst somit die Funktionstüchtigkeit der betroffenen Menschen enorm.[6] Bei der Entstehung von depressiven Störungen wird von einem komplexen Zusammenspiel sozialer, biologischer und psychischer Faktoren ausgegangen.[7]
Mittlerweile gibt es viele verschiedene Präventions- bzw. Therapieansätze, die eine Depression lindern beziehungsweise im Optimalfall komplett vermeiden sollen. Die klassischen Therapieansätze sind die medikamentöse und die therapeutische Behandlung.[8] Ein Ansatz könnte allerdings auch Sport und Bewegung sein. Zur Auswirkung von Sport und Bewegung auf eine Depression gibt es eine Vielzahl von kontrollierten Studien mit guter methodischer Validität.[9] Laut den Studien entsteht bei regelmäßigem körperlichem Training eine bedeutsame antidepressive Wirkung.[10] Das sportliche Trainingsprogramm muss dabei sorgfältig und gleichzeitig vorsichtig aufgebaut werden. Klassische Ausdauersportarten wie Laufen, Schwimmen oder Radfahren sind besonders zu empfehlen.[11] Wichtig dabei ist es, die Möglichkeiten und Vorlieben des Betroffenen zu beachten. Für einen positiven Effekt ist nicht die Art der körperlichen Bewegung ausschlaggebend sondern vielmehr die Regelmäßigkeit und die Freude an der Bewegung, die oft erst nach einigen Monaten eintritt.[12]
Literatur:
Ärzteblatt (2017): WHO: Millionen leiden an Depressionen. Verfügbar unter: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/73297/WHO-Millionen-leiden-an-Depressionen.Zugriff am 23.01.2019.
Broocks, Andreas (2003): Depressive Störungen. In: Reimers, Carl D./ Broocks, Andreas (Hrsg.): Neurologie, Psychiatrie und Sport. Stuttgart: Georg Thieme Verlag. S. 190-196.
Cless, Katharina; Matura, Silke (2017): Psychische Gesundheit. In: Oertel, Viola: Matura, Sile (Hrsg.): Bewegung und Sport gegen Burnout, Depressionen und Ängst. Berlin: Springer Verlag.
Essau, Cecilia A. (2002): Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. München: Ernst Reinhardt Verlag.
Ihle, Wolgang; Groen Gunter, Walter, Daniel; Esser, Günter; Petermann, Franz (2012): Depression. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
Ruf, Gerhardt Dieter (2015): Depression und Dystymia. Heidelberg: Carl- Auer- Systeme Verlag.
[1] Vgl. Ärzteblatt (2017): o.S.
[2] Vgl. Cless, Katharina; Matura, Silke (2017): S. 14 f.
[3] Ruf, Gerhardt Dieter (2015): S. 9.
[4] Vgl. Essau, Cecilia A (2002): S. 17.
[5] Vgl. Essau, Ceclilia A (2002): S. 17.
[6] Vgl. Essau, Cecilia A (2002): S. 17.
[7] Vgl. Ihle, Wolfgang; Groen, Günter; Walter, Daniel; Esser, Günter; Petermann, Franz (2012): S. 15.
[8] Vgl. Ihle, Wolfgang; Groen, Günter; Walter, Daniel; Esser, Günter; Petermann, Franz (2012): S. 15.
[9] Vgl. Broocks, Andreas (2003): S. 90.
[10] Vgl. Broocks, Andreas (2003): S. 90.
[11] Vgl. Broocks, Andreas (2003): S. 191.
[12] Vgl. Broocks, Andreas (2003): S. 195.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt und allgemeine Lebenszufriedenheit
Geschrieben von Omer Baktash
Student im Master „Soziale Arbeit und Gesundheit im Kontext soziale Kohäsion“, 3. Semester.
Der vorliegende Beitrag analysiert, welche Bedeutung der soziale Zusammenhalt auf die allgemeine Lebenszufriedenheit hat.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt und allgemeine Lebenszufriedenheit sind übergreifende Konzepte und zeichnen sich durch ihre Mehrdimensionalität aus. Es besteht in der Literatur keine einheitliche Definition, jedoch heißt es in der Praxis, dass „sozialer Zusammenhalt“ das Merkmal eines Kollektivs und nicht von Individuen ist. Gesellschaften (z.B. Regionen, Gemeinden und Stadtviertel) können somit einen mehr oder weniger starken Zusammenhalt aufweisen. Ob der Zusammenhalt einen Einfluss auf die allgemeine Lebenszufriedenheit hat, wurde in vielen Studien untersucht.[1]
Zunächst eine Definition der Bertelsmann Stiftung für gesellschaftlichen Zusammenhalt:
„Eine kohäsive Gesellschaft ist gekennzeichnet durch belastbare soziale Beziehungen, eine positive emotionale Verbundenheit ihrer Mitglieder mit dem Gemeinwesen und eine ausgeprägte Gemeinwohlorientierung. Soziale Beziehungen repräsentieren hierbei das horizontale Netz, das zwischen einzelnen Personen und Gruppen innerhalb der Gesellschaft existiert.“[2]
Aus der Literatur geht hervor, dass verschiedene persönliche Eigenschaften das subjektive Wohlbefinden stark beeinflussen. Gleichwohl zeigt sich, dass auch sozio-ökonomische gesellschaftliche Kennzahlen wie der Wohlstand eines Landes und seine Verteilung bzw. Einkommensungleichheit, Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, als auch auf das subjektive Wohlbefinden haben.[3]
2011 wurde der gesellschaftliche Zusammenhalt in Europa untersucht, dabei landete Deutschland auf dem 12. Platz. Den höchsten gesellschaftlichen Zusammenhalt hatte Dänemark.[4]
(Quelle: Bertelsmann Stiftung (2015), S.9)
In mehreren Studien wurde die Beziehung zwischen gesellschaftlichem Zusammenhalt und Lebenszufriedenheit eingehend untersucht und eine deutliche positive Korrelation festgestellt.[5] Eine Analyse der Bertelsmanns Stiftung zeigte eine besonders interessante Beziehung: Der gesellschaftliche Zusammenhalt beeinflusst das psychische Wohlbefinden, am stärksten. Es heißt in der Studie:
„Wer in eher kohäsiven Gesellschaften lebt, betrachtet die Zukunft optimistischer und sieht mehr Lebenssinn und größere Freiheit bei der Lebensgestaltung.“[6]
Viele weitere Studien bestätigen diesen starken Einfluss, insbesondere die Murayama Studie aus 2015, welche einen sogenannten „stress-buffering effect“ entdeckt hat in Regionen, in denen der Zusammenhalt hoch war.[7]
Es ist also abschließend davon auszugehen, dass Interventionen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt verbessern, auch dabei helfen für mehr Lebenssinn und Optimismus bei den jeweiligen Menschen zu sorgen.
Literatur
Bertelsmann Stiftung (2013): Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt: messen was verbindet. Gesellschaftlicher Zusammenhalt im internationalen Vergleich. Gütersloh.
Bertelsmann Stiftung (2015): Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Wohlbefinden in der EU. Gütersloh.
Gao J., Weaver SR., Fu H., Jia Y., Li J. (2017): Relationship between neighborhood attributes und subjective well-being among the Chinese elderly: Data from Shanghai.
Larsen M.M., Esenaliev D., Brück T., Boehnke K. (2018): The connection between social cohesion and personality: A multilevel study in the Kyrgyz Republic.
Murayama H., Nishi, M., Nofuji Y., Matsuo E., Taniguchi, Y., Amano H., Yokoyama Y., Fujiwara Y., Shinkai S. (2015): Longitudinal association between neighborhood cohesion and depressive mood. A prospective study.
[1] Bertelsmann Stiftung (2015), S.6f.
[2] Ebd. S.6.
[3] Gao et al. (2017). S.516ff.
[4] Bertelsmann Stiftung (2013): S.8.
[5] Larsen et al. (2018): S.5ff.
[6] Bertelsmann Stiftung (2015): S.13f.
[7] Murayama et al. (2015): S.270ff.
Gesundheitsschädigendes Verhalten der deutschen Bevölkerung: Allgemeiner Alkohol – und Tabakkonsum
Die deutsche Bevölkerung erhöht insgesamt das Gesundheitsbewusstsein, was im Gesundheitswesen und in der Politik einen zentralen Austausch zur Verbesserung darstellt. Dem Statistischen Bundesamt zufolge rauchen etwa 22,4% der gesamten Bevölkerung (Statistisches Bundesamt 2017). Anders ausgedrückt: Fast jeder vierte Einwohner greift regelmäßig zu Tabakwaren und schadet damit der eigenen Gesundheit sowie die der sozialen Umwelt. Die erhofften positiven Folgen durch Einführung eines verstärkten Nichtraucherschutzgesetzes zeigen nur langsam Wirkung: Die Anzahl der Nichtraucher ist im Mikrozensus von 2017 mit 77,7% um vier Prozentpunkte im Vergleich zur Befragung von 2009 angestiegen (Statistisches Bundesamt 2013; 2017). Die Erhöhung der Tabaksteuer scheint weniger Einfluss auf die Rauchgewohnheit zu nehmen als angenommen, besonders in den unteren Schichten ist der Tabakkonsum überdurchschnittlich bei beiden Geschlechtern vertreten (Helmert 1999; Weyers 2007). Insbesondere bei den sozial Benachteiligten wäre es in Anbetracht der finanziellen Situation von Vorteil, den Tabakkonsum zwecks Kostenersparnis einzustellen, jedoch scheint hier die Setzung der Prioritäten fehlerhaft. Als Begründung dafür geht man von ausbreitender Frustration der Betroffenen aus, aber auch von einer mangelhaften kompetenten Befähigung und geringeres Interesse an den Gesundheitsstatus als die besser gestellten Individuen in der deutschen Gesellschaft (Helmert 1999).
Die neuesten Tabakproduktrichtlinien der Europäischen Kommission sollen zum Schutz des Verbrauchers die Prävention und Intervention des Rauchens fördern. Darunter fällt zum Beispiel, dass die Warnhinweise auf den Zigarettenschachteln und Tabaktüten, die seit Mai 2016 nicht nur aus Texten, sondern auch aus Bildern bestehen, insgesamt Dreiviertel der vorderen und hinteren Seite ausmachen sollen. Auch sollen überdeckende Aromen verboten werden (wie Menthol-Geschmack), um den leichtsinnigen Glauben der Konsumenten, einen weniger schädlichen Tabakkonsum zu praktizieren, zu entkräften. Diese sollen ab dem 01.05.2020 entsprechend der EU-Tabakrichtlinien vollständig vom Markt genommen werden. (Europäische Union 2018)
Der Alkoholverzehr genießt in der deutschen Bevölkerung allgemeine Anerkennung, was die Einschränkung komplizierter macht. Alkohol ist die einzige freigegebene Substanz, die überall erhältlich ist und eine legale Berauschung hervorrufen kann. Der diskutierte Gesichtspunkt bezüglich des jugendkulturellen Alkoholkonsums lässt die Gesellschaft aufhorchen, vor allem die Eltern von Kindern im Jugendalter. Hierbei wird die Tatsache, dass diese Phase der Grenzüberschreitung nahezu jeden in dieser Entwicklungszeit trifft, gerne ausgelassen. In der Regel gilt diese Etappe auch nur vorübergehend und stellt keinen Dauerzustand dar. Wie bei jedem Substanzmissbrauch geraten einige Verbraucher in die Abhängigkeit: Etwa zwei Millionen Menschen gelten als alkoholkrank (Pschyrembel 2018).
Im Jahr 2010 entsprach die Ausgabe für Krankheitskosten in Deutschland insgesamt 287 Mrd. Euro (Statistisches Bundesamt 2013). Darunter versteht man die Ausgaben für Prävention, Rehabilitation und Pflege von Krankheiten sowie von Unfällen. Bedenkt man, dass mehr als die Hälfte der Kosten davon aufgrund von Herz-Kreislauf-Krankheiten verursacht werden, rückt die Dringlichkeit der Aufgabe der Rauchgewohnheit, die zu eine der größten Risikofaktoren dazu gezählt werden, in ein anderes Licht.
Allgemein sollten weiterhin verstärkt Aufklärungskampagnen im schulischen Kontext den Gesundheitsaspekt unterstützen, ebenso im Beisein von Eltern, damit sie in ihrer Vorbildfunktion aktiv handeln können. Lobenswert sei an dieser Stelle die Bemühungen in Werbeaktionen im Fernsehen, in Kinos und in Zeitschriften zu erwähnen: Die Aufforderung, auf den Alkoholkonsum zu achten und über einen Rauchstopp nachzudenken, wird vermutlich positiv beeindruckend auf die Zielgruppe wirken. Die Gesundheitsförderung bleibt eines der wichtigsten Themen in Deutschland, welche noch mehr Entwicklung und Kontinuität bedarf. Die Besserung des Gesundheitsstatus fängt bei jedem einzelnen Individuum an. Wenn das Bewusstsein dafür im Kopf anfängt zu wachsen, wirkt sich die Überzeugung auf die gesamte Lebensqualität aus.
Verwendete Literatur:
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. 2012. Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2011. Teilband Rauchen. Köln.
Deutsche.Hauptstelle.für.Suchtfragen.e.V..2013..Alkohol..Hamm.
www.dhs.de/suchtstoffe-verhalten/alkohol.html (letzter Zugriff 10.12.18).
Deutsche.Hauptstelle.für.Suchtfragen.e.V..2013..Tabak..Hamm.
http://www.dhs.de/suchtstoffe-verhalten/tabak.html (letzter Zugriff 10.12.18).
Forberger, Sandra, Jürgen Rehm. 2010. Alkoholassoziierte Krankheitslast in Deutschland. Sucht aktuell Heft 1/2010. Fachvarband Sucht e.V. www.sucht.de/heft-12010.html ( letzter Zugriff 20.12.18).
Glaeske, Gerd. 2012. Kulturell erlaubt, trotz erheblicher Risiken – die Droge Alkohol. In Saufen mit Sinn? Harm Reduction beim Alkoholkonsum. Hrsg. Schmidt-Semisch, Henning, Heino Stöver, S. 39-55. Frankfurt/Main: Fachhochschulverlag.
Helmert, U. 1999. Einkommen und Rauchverhalten in der Bundesrepublik Deutschland – Sekundäranalyse der Daten des Mikrozensus 1995. In Gesundheitswesen 61 (1999), S. 31-37. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch. 2018. 267. Auflage. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.
Richter, Matthias. 2008. Tabakkonsum im Jugendalter zwischen sozialer Herkunft, Gleichaltrigengruppe und Schule. In Soziologie sozialer Probleme und sozialer Kontrolle. Realitäten, Repräsentationen und Politik. Hrsg. Groenemeyer, Axel, Silvia Wieseler, S. 375-395. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Statistisches Bundesamt. 2017. Mikrozensus – Fragen zur Gesundheit. Rauchgewohnheiten der Bevölkerung. Wiesbaden.
Statistisches Bundesamt. 2015. Gesundheit. Todesursachen in Deutschland. Wiesbaden.
Https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Todesursachen/Todesursachen.html (letzter Zugriff: 20.12.18).
Statistisches Bundesamt. 2018. Gesundheitsrelevantes Verhalten. Rauchgewohnheiten nach Altersgruppen..Ergebnisse.des.Mikrozensus.2017..Wiesbaden. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/GesundheitszustandRelevantesVerhalten/Tabellen/Rauchverhalten.html (letzter Zugriff: 20.12.18).
Weyers, Simone. 2007. Soziale Ungleichheit, soziale Beziehungen und Gesundheitsverhalten. Ergebnisse einer medizinsoziologischen Studie im Ruhrgebiet. Berlin: Lit Verlag.
Wolf, Christof. 2003. Soziale Ungleichheit, Krankheit und Gesundheit. Köln: Forschungsinstitut für Soziologie.
Spinnenphobie oder doch nur Angst? - Zur Verbreitung von Arachnophobie
von Blanca Homma, Dez. 2018, HS Emden/Leer.
Angst – das ist wohl eine der heftigsten Reaktionen, die bei Spinnenbegegnungen zutage kommen. Kreischen, umherfuchteln oder gar den Raum verlassen mit dem Hinweis „Ich habe Spinnenphobie“ ist eine alltägliche Szene, die gar nicht so selten auftritt. Doch was steht eigentlich dahinter?
Der Begriff „Spinnenphobie“, auch „Arachnophobie“, bezeichnet eine psychische Störung aus dem Spektrum der spezifischen Phobien (vgl. DIMDI 2016, S. 193). Spezifische Phobien sind Angststörungen, bei denen die Angst sehr klar auf gewissen Stimuli, die sogenannten „Angstobjekte“ (z. B. Tiere, Umweltphänomene, Blut, bestimmte Situationen) zurückzuführen sind (vgl. Hamm 2006, S. 1). Im Fall der Arachnophobie ist das Angstobjekt die Spinne. Obwohl die Angstreaktion zumeist wissentlich irrational ist, kann sie von den Betroffenen nicht gesteuert werden. Spezifische Phobien sind in der ICD anerkannte psychische Störungen. (vgl. ebd.) Eine klare Trennung muss daher zwischen den Begriffen Spinnenphobie und Spinnenangst stattfinden: Während eine Spinnenphobie eine psychische Störung, welche mit unterschiedlichen Therapieansätzen behandelbar ist (vgl. Meermann & Okon 2006, S. 28), beschreibt, bezeichnet der Begriff der Spinnenangst eine Angst aus dem Spektrum der alltäglichen Emotionen. Damit die Angst vor Spinnen als Phobie anerkannt wird, müssen vier Diagnosemerkmale erfüllt werden:
„ A. Entweder 1. oder 2.:
1. Deutliche Furcht vor einem bestimmten Objekt oder einer bestimmten Situation außer Agoraphobie oder Sozialer Phobie.
2. Deutliche Vermeidung solcher Objekte und Situationen außer Agoraphobie und Sozialer Phobie.
B. In den gefürchteten Situationen treten Angstsymptome auf […].
C. Es besteht die Einsicht, dass die Symptome und das Vermeidungsverhalten übertrieben und unvernünftig sind. […]
D. Die Symptome sind auf die gefürchtete Situation oder Gedanken an diese beschränkt.“ (Hamm 2006, S. 2f.)
Wie häufig ist also die Spinnenphobie tatsächlich – und handelt es sich nicht in den meisten Fällen um einfache Spinnenangst? Psychologe und Psychotherapeut Morschitzky behauptet, dass 35 % der Gesellschaft von Arachnophobie betroffen sind (vgl. Morschitzky 2009, S. 81). Eine steile These, dass mehr als ein Drittel der Gesellschaft eine psychische Störung aufweisen. Um diese Zahlen zu überprüfen, habe ich im Jahr 2018 eine Untersuchung dazu anhand der Studierenden der Hochschule Emden unternommen. Dafür wurden Studierende in einer quantitativen Erhebung befragt, wobei neben Items zu den Personendaten auch Items aus dem Spinnen-Angst-Fragebogen (SAF) (vgl. Rinck et al. 2002, S. 141) zur Diagnostik der spezifischen Phobie zum Einsatz kamen. Entsprechend den Diagnosemerkmalen spezifischer Phobien wurden darüber hinaus auch die körperlichen Symptome der Angstreaktion abgefragt. Weiterhin bekamen die Studierenden die Möglichkeit, sich in offenen Fragen auch qualitativ zu dem Thema zu äußern. Mit einer Rücklaufquote von n = 397 konnte eine für die Studierenden der Hochschule Emden repräsentative Befragung erreicht werden. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen eine klare Differenz zu Morschitzkys Behauptung: Lediglich 2,3 % der befragten Studierenden zeigten Anzeichen einer spezifischen Phobie vor Spinnen. Da die Befragung eine psychiatrische Diagnostik nicht ersetzen kann und die Diagnosemerkmale eher niedrig angesetzt wurden, ist von einer tatsächlich noch geringeren Anzahl Betroffener auszugehen. Die Angst vor Spinnen dagegen kam deutlich häufiger vor: Insgesamt 28,3 % der Befragten gaben an, Angst vor den harmlosen Tieren zu haben.
Diese Differenzen werfen die Frage auf, welche Daten Morschitzkys Behauptung zugrunde liegen. Obwohl diese Frage unbeantwortet bleibt, steht zu vermuten, dass dabei deutlich niedrigere Hürden für die Diagnostik der spezifischen Phobie vorlagen. Im wissenschaftlichen Diskurs ist die Diagnostik der Störung ein kontrovers diskutiertes Thema, da sie die Herausforderung mit sich bringt, ein bipolares Phänomen in ein dichotomes Konzept einzuordnen: Obwohl der Übergang zwischen Spinnenphobie und Spinnenangst vermutlich fließend ist, werden sie in zwei Kategorien gezwungen. Die diskutierte Frage ist dementsprechend: Wo auf dem Kontinuum zwischen Angst und Phobie wird die Grenze gesetzt? In der Fachliteratur sind die unterschiedlichen Positionen deutlich zu erkennen. Im Gegensatz zu Morschitzky setzen beispielsweise Brunnhuber et al. die Hürde deutlich höher:
„Bei einem Großteil der spezifischen Phobien ist der subjektive Leidensdruck nicht sehr hoch, da sie die persönliche Lebensführung nur in geringem Maße beeinträchtigen. Schwierigkeiten ergeben sich, wenn die gefürchteten Situationen im Alltag oder Berufsleben nicht vermieden werden können und zu einem Hindernis bei der Alltagsbewältigung oder für das berufliche Fortkommen werden (z. B. Flugangst bei einem Geschäftsreisenden). Erst dann wird nach der ICD-10 die phobische Symptomatik als psychische Erkrankung diagnostiziert.“ (Brunnhuber et al. 2005, S. 246)
Die neu erschienene ICD-11 Klassifikation hat diese Grenze daher stärker definiert. Während eine spezifische Phobie zuvor lediglich durch die irrationale Angst vor dem Angstobjekt definiert wurde (vgl. WHO 2016, o. S.), setzt die ICD-11 eine Belastung durch diese Angst voraus:
„Symptoms persist for at least several months and are sufficiently severe to result in significant distress or significant impairment in personal, family, social, educational, occupational, or other important areas of functioning.“ (WHO 2018, o. S.)
Dass diese starke Belastung bei der Angst vor Spinnen vorkommt, ist ein wahrscheinlich sehr seltenes Phänomen. Darauf weisen auch die Ergebnisse der Erhebung an der Hochschule Emden hin, wonach keine einzige befragte Person jemals professionelle Hilfen aufgrund ihrer Spinnenangst in Anspruch genommen hat. Daher kann geschlussfolgert werden, dass es sich bei Spinnenangst zwar um ein häufiges Phänomen handelt, jedoch nur in Einzelfällen die Ausprägung einer psychischen Störung vorkommt.
Literatur
Brunnhuber, Stefan; Frauenknecht, Sabine; Lieb, Klaus (2005): Intensivkurs Psychiatrie und Psychotherapie. Urban & Fischer Verlag. München/Jena
Hamm, Alfons (2006): Spezifische Phobien. Fortschritte der Psychotherapie. Hogrefe Verlag. Göttingen
Morschitzky, Hans (2009): Angststörungen. Diagnostik, Konzepte, Therapie, Selbsthilfe. Springer Verlag. Wien/New York
Meermann, Rolf; Onok, Eberhard (2006): Angststörungen: Agoraphobie, Panikstörung, spezifische Phobien. Ein kognitiv-verhaltenstherapeutischer Leitfaden für Therapeuten. Kohlhammer Verlag. Stuttgart
Rinck, Mike; Bundschuh, Sebastian; Engler, Stefanie; Müller, Anett; Wissmann, Johannes; Ellwart, Thomas; Becker, Eni S. (2002): Reliabilität und Validität dreier Instrumente zur Messung von Angst vor Spinnen. In: Diagnostica. Nr. 3. S. 141—149
WHO (2016): ICD-10. Online verfügbar unter: https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F40-F48 (Stand: 19.12.2018)
WHO (2018): ICD-11. Online verfügbar unter: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f239513569 (Stand: 19.12.2018)
Stillförderung – Familien abholen, wo sie sind und dahin begleiten, wo sie hinwollen
Geschrieben von Astrid Kruid
Das Stillen ist ein sehr emotional besetztes Thema. Mütter die gar nicht oder nur kurz stillen sind Rabenmütter; Mütter, die zu lang stillen, sind schlecht für die Entwicklung ihrer Kinder und deren Eigenständigkeit. Dass der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen von diversen anderen Faktoren, außer vom Stillen, abhängt, sollte bei kurzem Überlegen den meisten Menschen klar sein. Trotz allem ist es unbestritten, dass das Stillen sehr viele Vorteile für die Gesundheit und die Entwicklung des gestillten Kindes aber auch der Mutter hat. So leiden gestillte Kinder zum Beispiel seltener an Infektionen des Magen-Darm-Traktes oder an allergischen Hauterkrankungen (Kramer et al. 2000) und haben später seltener krankhaftes Übergewicht oder einen Diabetes Typ II (Horta, Cesar 2013). Mütter, die gestillt haben, haben beispielsweise ein geringeres Risiko später Brustkrebs (Newcomb et al. 1994; Zeng et al. 2001) oder Bluthochdruck (Adair, Dahly 2005) zu entwickeln. Noch immer werden neue Inhaltsstoffe in der Muttermilch gefunden und noch immer gibt es neue Erkenntnisse zu positiven Folgen des Stillens, bzw. ungünstigen Folgen des Nicht-Stillens. Dies alles sollte überzeugen, die Stillförderung in Deutschland voran zu treiben und Schwangere und junge Mütter motivieren mit dem Stillen zu beginnen und es einige Monate weiter zu führen. Was jedoch nicht passieren sollte, ist ein gesellschaftlicher Druck, dass jedes Kind, gemäß der WHO-Empfehlung (Dewey 2003), sechs Monate voll gestillt werden muss. Müttern sollten zum einen dieser Druck genommen werden und zum anderen möglichst stillfreundliche Bedingungen geboten werden, die sie in ihren Bemühungen, ihre Kinder zu stillen, unterstützen!
In Deutschland gab es Ende der 1990er Jahre eine Erhebung zu Stillraten und Stilldauer (SuSe, Stillen und Säuglingsernährung; Dulon, Kersting 2000) die derzeit ein zweites Mal durchgeführt wird. Damit wird eine mögliche Veränderung des Stillverhaltens in den letzten 20 Jahren dargestellt werden können. Eine weitere große und erstmals repräsentative Studie (KIGGS Welle 2), die im Gegensatz zur SuSe Studie auch Frühgeborene und kranke Neugeborene miteinschloss, wurde gerade veröffentlicht (Brettschneider et al. 2018). Auf Grund der unterschiedlichen Herangehensweisen sind die Ergebnisse der beiden Studien nicht direkt miteinander zu vergleichen. Gleichwohl sollen die Zahlen nachfolgend nebeneinander dargestellt werden.
|
Stillbeginn | 4 Monate voll gestillt | 4 Monate gestillt plus andere Nahrung | 6 Monate voll gestillt | 6 Monate gestillt plus andere Nahrung | 12 Monate gestillt plus andere Nahrung |
SuSe (Erhebung 1997-98) | 91 % | 33 % | 55 % | 10 % | 43 % | 9 % |
KIGGS (Jahrg. 2009-10) | 86 % | 45 % | 66 % | 12 % | 55 % | 22 % |
KIGGS (Jahrg. 2013-14) | 87 % | 46 % | 66 % | 15 % | 56 % | 20 % |
Insbesondere der Vergleich der KIGGS Daten der Jahrgänge 2009 - 2010 und der Jahrgänge 2013 – 2014 zeigt, dass in diesem Zeitraum nur eine geringe Verbesserung der Stillraten zu verzeichnen war. Gleichzeitig gaben Mütter, wenn sie nach ihren Gründen für das Abstillen gefragt wurden, sehr häufig Stillprobleme wie Schmerzen beim Stillen und zu wenig Milch an. Nur wenige gaben an, sie hätten nicht länger stillen wollen. Besonders die Mütter, die wegen Stillproblemen abstillen, gilt es zu erreichen. Sie sollten eine stillfreundliche Umgebung vorfinden, die sie unterstützt, ihr Stillziel wertfrei zu erreichen. Egal ob dieses bei acht Wochen, vier Monaten oder längerem Stillen liegt. Jegliches Stillen hat Vorteile für Mutter und Kind. Eventuell ist es eine realistische Alternative für einzelne Mütter, das Stillen mit ergänzender anderer Ernährung fortzuführen. Damit dies gelingt brauchen sie eine professionelle Unterstützung durch Geburtskliniken, Hebammen, Stilberater*innen und Gynäkolog*innen. In diesem Bereich werden also flächendeckend gut qualifiziertes Personal und Konzepte zur Stillförderung und zur interdisziplinären Zusammenarbeit benötigt. Das international angelegte Forschungsprojekt „Becoming Breastfeeding Friendly“ setzt derzeit hier an und will die aktuelle Situation der Stillförderung in Deutschland abbilden und daraus Handlungsempfehlungen für eine weitere Verbreitung und eine Ausdehnung der Dauer des Stillens ableiten (Gesund ins Leben 2018, o. S.).
Literatur
Adair, L., Dahly, D. (2005): Developmental determinants of blood pressure in adults. Annu Rev Nutr 2005; 25: 407–34
Brettschneider. A.-K.; Lippe, von der, E.; Lange, C. (2018): Stillverhalten in Deutschland- Neues aus der KIGSS Welle 2. In: Bundesgesundheitsblatt 61: 920-925
Dewey, K. (2003): Guiding principles for complementary feeding of the breastfed child, WHO, Washington
Dulon, M.; Kersting, M. (2000): Stillen und Säuglingsernährung in Deutschland – die SuSe-Studie. In: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.) Ernährungsbericht 2000. DGE, Frankfurt, 81–95
Gesund ins Leben (2018): Becoming Breastfeeding Friendly. www.gesund-ins-leben.de/inhalt/warum-gibt-es-das-vorhaben-30514.html , Abruf am 06.12.2018
Horta, L. B.; Cesar, G. V. (2013): Long-term effects of breastfeeding: a systematic review, WHO, Genf
Kramer M.S.; Chalmers, B.; Hodnett, E. D.; Sevkovskaya, Z.; Dzikovich, I.; Shapiro, S.; Collet, J. P. ; Vanilovich, I.; Mezen, I.; Ducruet, T. Shishko, G.; Zubovich, V.; Mknuik, D.; Gluchanina, E.; Dombrovskiy, V.; Ustinovitch, A.; Kot, T.; Bogdanovich, N.; Ovchinikova, L.; Helsing, E. (2000): Promotion of breastfeeding intervention trial (PROBIT): a cluster-randomized trial in the Republic of Belarus. Adv Exp Med Biol 2000; 478: 327-345
Newcomb, P. A.; Storer, B. E.; Longnecker, M. P.; Mittendorf, R.; Greenberg, E. R.; Clapp, R. W.; Burke, K. P.; Willett, W. C.; MacMahon, B. (1994): Lactation and a reduced risk of premenopausal breast cancer. N Engl J Med 1994; 330: 81-87
Zheng, T.; Holford, T. R.; Mayne, S. T.; Owens, P. H.; Zhang, Y.; Zhang, B.; Boyle, P.; Zahm, S. H. (2001): Lactation and breast cancer risk: a case–control study in Connecticut. Br J Cancer 2001 June; 84(11): 1472–1476
Das Asperger-Syndrom
In diesem Fachbeitrag soll die aktuelle Klassifikation der Autismus-Spektrum-Störungen (ICD 10, F84) kurz erläutert werden: zu diesem gehört das sogenannte Asperger-Syndrom (F 84.5), das neben dem Frühkindlichem Autismus (F 84.0), und Atypischen Autismus (F 84.1) zur Reihe der Autismus-Spektrum-Störungen gehört1. Bei dem Asperger-Syndrom handelt es sich gegenüber dem frühkindlichem und atypischem Autismus um eine vergleichsweise gering auffällige Behinderung, die sich in einem abweichendem Sozialverhalten und eingeschränkter Psychomotorik äußert2. Meistens ergeben sich die ersten Probleme mit dem Schulbeginn, wenn dort das Sozialverhalten des Kindes abweichend von denen der Gleichaltrigen wahrgenommen wird3,4. In den meisten Fällen ist die Ausbildung der Intelligenz normal bis überdurchschnittlich, lediglich werden diese Kinder als seltsam oder auffällig beschrieben, unter anderem weil diese zum Beispiel das Verhalten der anderen Kinder nicht antizipieren können, bzw. als sonderbar wahrgenommen werden5. Kinder mit Asperger-Syndrom haben für ihr Alter eher ungewöhnliche Hobbies und Interessen6. Auch weicht die sprachliche Artikulationsfähigkeit der Kinder von denen Gleichaltriger ab7. Man muss allerdings dazu sagen, dass hier individuelle Ausprägungen existieren und die beschriebenen Merkmale unterschiedlich auftreten. Auch können diese Kinder häufig nur sehr schwer mit kurzfristigen Veränderungen umgehen, weil sie sich nicht so schnell auf neue Situationen einstellen können8.
Die Diagnose wird nicht selten erst spät festgestellt, manchmal bis ins höhere Erwachsenenalter. Bis dahin können sich zu dem Syndrom auch noch weitere psychische Erkrankungen gesellen, die für Aspergerautisten typisch sind9. Insgesamt wird den AutismusSpektrum-Störungen bzw. den autistischen Erkrankungen erst seit den neunziger Jahren vermehrt Aufmerksamkeit gewidmet, so dass zum Bedarf noch nicht die nötige Infrastruktur (Therapieeinrichtungen etc.) geschaffen ist10. Somit ist die Anzahl der therapeutischen Einrichtungen also noch nicht ausreichend. Gerade bei Erwachsenen gibt es Probleme wegen langer Wartezeiten, um erst einmal überhaupt eine Diagnose vornehmen zu lassen. Hier wäre jetzt der Ansatzpunkt für eine Therapie, um den sozialen Umgang mit anderen zu trainieren. Bei Kindern müssen Lehrkräfte deren Besonderheiten in der Unterrichtsgestaltung berücksichtigen, damit auch im Schulalltag Wege gefunden werden können um das Schulziel für alle Seiten zufriedenstellend zu lösen11. Auch Erwachsene können mit therapeutischer Unterstützung den Weg ins Berufsleben (zurück-)finden, um so eine dauerhafte Arbeitslosigkeit zu vermeiden12.
1 Der Bundesverband autismus Deutschland e. V. (o. J.): Was ist Autismus? O. O. o. S. www.autismus.de/was-ist-autismus.html (zuletzt abgerufen am 05.03.2018)
2 Der Bundesverband autismus Deutschland (o.J.): Elternratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Hamburg. www.autismus.de/fileadmin/user_upload/Elternratgeber_final.pdf (zuletzut abgerufen am 05.03.2018)
3Ebd.
4 Sozialverband VdK Deutschland e. V. (2012): Kinder mit Asperger-Syndrom: Wozu „Hallo“ und „Tschüss“ sagen? Berlin. O. S. www.vdk.de/deutschland/pages/28135/kinder_mit_asperger_syndrom_wozu_hallo_und_tschuess_sagen (zuletzt abgerufen am 05.03.2018
5 Der Bundesverband autismus Deutschland (o.J.): Elternratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Hamburg. www.autismus.de/fileadmin/user_upload/Elternratgeber_final.pdf (zuletzut abgerufen am 05.03.2018)
6 Remschmidt, Helmut; Kamp-Becker, Inge (2007): Das Asperger-Syndrom – eine Autismus-Spektrum-Störung. In: Deutsches Ärzteblatt (Hrsg.). 2007. 104(13): A-873 – A82. www.aerzteblatt.de/pdf.asp (zuletzt abgerufen am 05.03.2018)
7 Der Bundesverband autismus Deutschland (o.J.): Elternratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Hamburg. www.autismus.de/fileadmin/user_upload/Elternratgeber_final.pdf (zuletzut abgerufen am 05.03.2018)
8 Roy, Mandy; Dillo, Wolfgang; Emrich, Hinderk M.; Ohlmeier, Martin D. (2009): Das Asperger-Syndrom im Erwachsenenalter. In: Deutsches Ärzteblatt (Hrsg.). 2009; 106(5): 59-64. www.aerzteblatt.de/archiv/63173/Das-Asperger-Syndrom-im-Erwachsenenalter (zuletzt abgerufen am 05.03.2018)
9 Der Bundesverband autismus Deutschland e. V. (o. J.): Was ist Autismus? O. O. o. S. www.autismus.de/was-ist-autismus.html (zuletzt abgerufen am 05.03.2018)
10 Philipps Universität Marburg (2015): AG Autismusspektrum. Marburg. O. S. www.unimarburg.de/fb20/kjp/forschung/aut (zuletzt geöffnet am 05.03.2018) und Philipps Universität Marburg (2013): Geschichte der autistischen Störungen. Marburg. O. S. www.unimarburg.de/fb20/kjp/forschung/aut/ass/geschichte (zuletzt abgerufen am 05.03.2018)
11 Hessisches Kultusministerium (2016): Einstiegshilfen für den Unterricht von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum. Wiesbaden. kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/einstiegshilfen_fuer_den_unterricht_von_kindern _und_jugendlichen_im_autismus-spektrum.pdf (zuletzt abgerufen am 05.03.2018)
12 Feuerbach, Leonie (2015): Ein Autist in der Arbeitswelt. In: Frankfurter Allgemeine. 04.01.2015. o. S. www.faz.net/aktuell/wissen/leben-gene/asperger-syndrom-ein-autist-in-der-arbeitswelt-13345066.html (zuletzt abgerufen am 05.03.2018)
„Heimärztliche Versorgung“ in Pflegeheimen
Die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in Deutschland rückt immer mehr in den öffentlichen Fokus unserer Gesellschaft. Laut Statistiken wird zwar der Großteil der zu Pflegenden weiterhin zuhause versorgt, jedoch zeigt eine Pflegedatenbank, dass es bundesweit ca. 11.390 Pflegeheime gibt, in denen ca. 783.000, pflegebedürftige versorgt werden1. Mit der pflegerischen Versorgung im Pflegeheim ändern sich viele Strukturen im Lebensalltag der Betroffenen. Allerdings bleibt in der Regel der bis zum Einzug in eine Pflegeeinrichtung betreuende Hausarzt weiter für den Patienten bestehen. Dies bringt enorme Herausforderungen für die Pflegeeinrichtungen mit sich. Denn viele unterschiedliche niedergelassene Ärzte besuchen zu unterschiedlichen Zeiten oft unstrukturiert und qualitativ unterschiedlich ihre Patienten. Durch dieses unkoordinierte Vorgehen müssen in Notlagen oft Notärzte und Rettungsdienstpersonal alarmiert, und Heimbewohner unnötig in Krankenhäuser verlegt werden. Darüber hinaus finden an Wochenenden sowie Feiertagen in der Regel keine Visiten durch die Hausärzte in den Pflegeeinrichtungen statt. Auch die Arztpraxen haben mit einer zusätzlichen Belastung durch dieses Vorgehen zu kämpfen.2
Um diesem Problem entgegen zu wirken wurde das „Heimarztmodell“ eingeführt, welches die niedergelassenen Arztpraxen entlasten und die Gesundheit der Pflegeheimbewohner qualitativ verbessern soll. Zusätzlich soll durch neuentwickelte standardisierte Prozesse die Arbeit und Kommunikation zwischen den Schnittstellen Arztpraxis und Pflegeheim besser gelingen mit dem Ziel, die Lebensqualität der Bewohner zu steigern. Aber auch das Pflegepersonal in den Einrichtungen soll durch diesen Prozess effizienter arbeiten können. Um diese Ziele erreichen zu können, stellte z.B. das Lingner Ärztenetzwerk „genial eG“, das dieses Projekt durchführt einen Arzt ein, der als sogenannter „Heimarzt“ bezeichnet wird. Mithilfe dieses Arztes soll durch festgelegte Standards und Leitlinien eine bessere medizinische Versorgung gewährleistet werden. Die erstellten Leitlinien sollen sicherstellen, dass Heimbewohner einen festen ärztlichen Ansprechpartner haben. Auch ist vorgesehen, dass die Pflegefachkräfte die anstehenden Visiten der Ärzte mit begleiten. Darüber hinaus soll der Heimarzt seine Anordnungen wie Medikation und Therapien für das Pflegepersonal einsehbar dokumentieren und protokollieren. Die Pflegekräfte sollen beim Ausarbeiten der Anordnungen die zuständige Apotheke über Medikamentenänderungen informieren.3
Eine wesentliche Erleichterung für die organisatorischen Abläufe und die Kommunikation zwischen Hausarzt und Pflegepersonal bildet bei diesem Modell die Tatsache, dass anstelle einer Vielzahl unterschiedlicher Hausärzte der „Heimarzt“ den zentralen Ansprechpartner für das Pflegepersonal und die Pflegeeinrichtung bildet. Um das Heimarztmodell weiter auszubauen und die Versorgungsqualität weiterer Betroffener zu verbessern sollen weitere Pflegeeinrichtungen in das Modellprojekt miteingebunden werden.4
Literaturangaben:
Hentrich, W., Schwerdt, C. (2011): Heimarztmodell. Konzept zur Heimarztversorgung durch einen angestellten Arzt. Verfügbar unter www.msd.de/fileadmin/user_upload/Heimarztmodell.pdf (Datum des Zugriffes, 31.01.2018)
Lohbeck, R. (2005): Pflegeheime: Das „Heimarztmodell. In: Deutsches Ärzteblatt, Heft 46, S. 3176-3177. Verfügbar unter: www.aerzteblatt.de/pdf.asp (Datum des Zugriffes, 31.01.2018)
Meisner, S. (2016): Anzahl der Statistik der Altenheime in Deutschland. Verfügbar unter: www.pflegemarkt.com/2016/10/28/anzahl-und-statistik-der-altenheime-in-deutschland/ (Datum des Zugriffes, 31.01.2018)
Geschrieben von
Hendrik Eiynck
Student im Master Soziale Arbeit und Gesundheit im Kontext Sozialer Kohäsion, 3. Semester
[1] Vgl. Meisner, S. (2016): Anzahl und Statistik der Altenheime in Deutschland. Verfügbar unter: www.Pflegemarkt.com/2016/10/28/anzhal-und-statisk-der-altenheime-in-deutschhland/
[2] Vgl. Deutsches Bundesärzteblatt, Heft 46, 2005. S. 3176
[3] Vgl. Hentrich, W., Schwerdt, C. (2011): Heimarztmodell. Konzept zur Heimarztversorgung durch einen angestellten Arzt. Verfügbar unter: msd.de/fileadmin/user _upload/Heimarztmodell.pdf
[4] Vgl. ebd.
Wearables - Datenkraken oder Revolution des Gesundheitssystems?
Geschrieben von
Ina Ostermann
„Ich möchte einfach fitter werden.“ Dies ist wohl einer der häufigsten Neujahrsvorsätze der Bundesrepublik. Die Fitnessbranche und Gesundheitsindustrie boomt, immer neue Trends überspülen den bereits bunt ausstaffierten Markt. Wichtige Faktoren für diese Entwicklung sind der Drang nach Selbstdarstellung und Optimierung sowie das neu ausgeprägte Gesundheitsbewusstsein der Gesellschaft (vgl. Becker et al. 2017: 501).
Wearables oder Wearble Devices liegen im Zeichen der Zeit, sie sind klein und je nach Wunsch unauffällig oder modern ausgefallen, der technische Fortschritt, in Verbindung mit immer günstiger werdenden Displays, Sensoren und Computern sowie die weite Verbreitung von Smartphones machen diese Entwicklung möglich (vgl. ebd.). Wearables verbinden die Technik von Smartwatch, Sportuhr und Fitnesstracker zu einem Gerät (vgl. Urban 2018: 149). Es handelt sich dabei um kleinste Computer, die beispielsweise in Form von Schmuck, wie Armbändern oder Uhren direkt am Körper getragen werden (vgl. Becker et. al. 2017: 501). Marken wie Jawbone® sind durch eingängige Werbungen bekannt, in denen das Produkt als unbedingter Indikator für vitale Leistungsfähigkeit dargestellt wird (vgl. Rode 2018: 132). Hierzu sind Wearables mit GPS Sendern und unterschiedlichsten Sensoren ausgestattet, zählen Schritte durch gemessene Distanzen und Bewegungssensoren (vgl. ebd.). Wenn diese Daten in Form der gelaufenen Gesamtkilometerzahl, der Anzahl der dazu gelaufenen Schritte und der dabei verbrannten Kalorien, am Abend auf dem Display erscheint, kann dies sehr motivierend auf die Nutzer_innen wirken (vgl. Becker et al. 2017: 509). Je nach Modell werden aber noch viele weitere gesundheitsrelevante Daten, wie beispielsweise Pulsfrequenz, Blutdruck, Muskelspannungen oder der Schlafrhythmus gemessen (vgl. Urban 2018: 150). Speziellere Geräte auf dem Gebiet der Kardiologie können sogar noch mehr, der Patient ist jetzt selbst in der Lage, das Monitoring von Ödemen zu übernehmen. Auch EKG-Anwendungen sind bereits möglich und decken so inzwischen auch medizinische Dienstleistungen ab (vgl. Kapitza 2015: 53). Damit bieten Wearables, eine bunte Palette an Möglichkeiten zur individuellen Gesundheitsförderung und Versorgung, dabei steht der gesamte Gesundheitssektor erst am Anfang der „digitalen Transformation“ (Bauer 2018: 3 f.). Untersuchungen belegen, dass das Selftracking innerhalb der nächsten Jahre zu einem Massenphänomen in den Industrienationen wird (vgl. ebd.: 4). Vorteile werden derzeit besonders bei dem erleichterten Informationsfluss zwischen Patienten, Krankenkassen, Arztpraxen und Krankenhäusern, gesehen (vgl. ebd.).
Was lange Utopie war, ist jetzt alltägliche Gewohnheit, ein Szenario wäre derzeit schon, dass ein Wearable immer an eine Medikamenteneinnahme erinnert. Der Nutzer/ die Nutzerin nimmt das Medikament ein und reagiert auf die Erinnerungsfunktion mit einer Bestätigung. Automatisch wird errechnet, dass das Medikament nur noch für fünf Tage vorrätig ist, deshalb wird über die zugehörige App (Application/Programm) eine Anfrage an die zuständige Arztpraxis gestellt oder ein Anruf per Push Mitteilung vorgeschlagen. Die Arztpraxis stellt daraufhin ein Rezept aus, das am Folgetag abgeholt werden kann, die Erinnerung zur Abholung erscheint am nächsten Tag nach Feierabend automatisch auf dem Display. (vgl. ebd.: 3). Denkbar ist auch, dass in Zukunft das Rezept digital verarbeitet wird und direkt über eine App an die Online-Apotheke des Vertrauens übermittelt wird, dabei müsste der Nutzer/ die Nutzerin nur noch per Button die Bestellung abschließen. Auch eine Digitale-Krankenakte wird so umsetzbar, Daten verschiedener Arztpraxen werden leichter vernetzt (vgl. ebd.: 4). Im Hinblick auf den Demografischen Wandel zunächst eine sehr vorteilhafte Entwicklung, denn diese automatisierten Vorgänge sparen viel Zeit und Personal, im Endeffekt also auch Kosten (vgl. ebd.). In diesem Beispiel wird jedoch auch die Gefahr der Weitergabe gesundheitsrelevanter Daten deutlich, denn in der Regel verbleiben die sensiblen Daten nicht auf dem Gerät selbst, sondern werden mittels Bluetooth an das Smartphone weitergeleitet und an den Server des Anbieters übermittelt oder direkt an Apps kommuniziert (vgl. Bauer 2018: 5). Transparenz darüber, wie diese Daten verarbeitet und an wen sie weitergeleitet werden, ist in den meisten Fällen nicht gegeben (vgl. Bauer 2018: 4).
Die Krankenkasse Gernerali hat unlängst auf den aktuellen Trend reagiert und ein besonderes Bonusprogramm entwickelt, in welchem die Teilnehmer_innen dazu aufgefordert werden, einen Tracker zu tragen und die erhobenen Daten an die Krankenkasse zu übermitteln. Diese versucht auf Grundlage des Datensatzes den Lebensstil der Person einzuschätzen und auszuwerten. Bei einem “guten Lebensstil“ werden Prämien ausgezahlt (vgl. Becker et al. 2017: 510). Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass ethische Bedenken angebracht sind, denn was passiert mit den Nutzerprofilen und den daraus erschlossenen Daten? Es ist zwar noch unklar, ob Krankenkassen langfristig die Datenauswertung der Wearables für sich nutzen, wenn dies jedoch geschieht, ist fraglich was mit den Nutzern und Nutzerinnen geschieht, bei denen ein “schlechten Lebensstil“ analysiert wurde. Werden diese womöglich eine Kündigung der Krankenkasse erhalten? Eine allzu naive Weitergabe dieser privaten Daten kann zudem weitreichende individuelle Folgen haben, schließlich gibt es auch Erkrankungen, die gesellschaftlich negativ stigmatisiert werden (vgl. Bauer 2018: 15). Somit stellt diese Entwicklung auch ein Risiko für die Soziale Kohäsion dar, Menschen die HIV positiv sind, werden schnell identifiziert und gesellschaftlich exkludiert oder diskriminiert (vgl. ebd.). Die durch zunehmende Digitalisierung ohnehin schon „gläsernen Menschen“ (Becker et al. 2018: 511), werden durch die ständige Überwachung der Vitalwerte und Weitergabe medizinischer Daten, auch gefährlich in ihrer Privatsphäre verletzt.
Literaturverzeichnis
Bauer, C. (2018): Der vernetzte Alltag und Daten. In: Bauer, C., Eickmeier, F., Eckard, M. (Hrsg.) E-Health: Datenschutz und Datensicherheit, Springer: Wiesbaden S. 3-19
Becker, K., Stemmer, Y. (2017): Sensorbasierte Gesundheitsservices für mehr Fitness im Alltag. In: Müller-Mielitz, S., Lux, T. (Hrsg.) E-Health-Ökonomie. Springer: Wiesbaden. S. 501-516
Kapitza, T. (2015): Megatrend eHealth Mobility. Stellenwert für den Kardiologen. In: Wien klin Mag 18. Springer: Wien. S. 52-57
Rode, D. (2018): Ein neues Spiel mit Körper und Technik – Self-Tracking vom Spiel aus betrachtet. In: M. Klemm und R. Staples (Hrsg.), Leib und Netz, Medienkulturen im digitalen Zeitalter. Springer: Wiesbaden. S. 129-147
Urban, M. (2018): Doing digital health. Zur Verschränkung von Leib und Netz in digitalen Gesundheitspraktiken. In: M. Klemm und R. Staples (Hrsg.), Leib und Netz, Medienkulturen im digitalen Zeitalter. Springer: Wiesbaden. S. 149-173
Gesundheitsförderung von Studierenden im Setting der Hochschule
Geschrieben von
Sophie Therese Schlüter
Seit der Bologna-Reform wird die Gesundheit bzw. der Gesundheitszustand von Studierenden genauer in den Blick genommen, da weitreichende Veränderungen auf diese zukamen (vgl. Kirsch et al. 2017:181). Es erhöhte sich sowohl der Leistungsdruck als auch der Erwartungsdruck, sodass viele angaben, unter Stress zu stehen bzw. erschöpft zu sein (vgl. ebd.). Ebenso sind sie speziellen Entwicklungsanforderungen ausgesetzt, die erfüllt bzw. bewältigt werden müssen (vgl. Hofmann et al. 2017: 395). Durch die neuen Anforderungen fühlen sich Studierende überfordert und der ausgelöste Stress hat auf Dauer einen negativen Einfluss auf ihre Gesundheit. Da aber für ein erfolgreiches Studium eine gelungene Work-Life-Balance von großer Bedeutung ist (vgl. Hofmann et al. 2017: 395), müssen die Belastungen reduziert werden bzw. ein gesundheitsfördernden Ausgleich gefunden werden (vgl. Göring/Möllenbeck 2010: 238).
Um den Studierenden ein möglichst gesundes Umfeld zum Lernen zu schaffen, können die Hochschulen an einigen Punkten ansetzen. So kann zuerst der Sport genannt werden, der von vielen zur Stressbewältigung genutzt wird (vgl. Kirsch et al. 2017: 186) und für die Gesundheitsförderung an Hochschulen eine bedeutende Ressource in Form des Hochschulsports darstellt (vgl. Göring/Möllenbeck 2010: 242). Hier sollten die Hochschulen ein Augenmerk auf Entspannungsangebote legen, die ebenfalls eine Möglichkeit der Stressbewältigung bieten (vgl. Kirsch et al. 2017: 186). Sie sollten aber auch Angebote schaffen, die die unterschiedlichen Studienabschnitte, wie Studienbeginn oder Prüfungsphasen berücksichtigt. Ebenso solltne für die Wahrnehmung und Ausübung des Hochschulsports bzw. der Entspannungsangebote ausreichende Freiräume für Studierende geschaffen werden, damit diese genutzt werden können (vgl. Göring/Möllenbeck 2010: 242).
Neben dem Hochschulsport können die Hochschulen auch begleitende Seminare anbieten, vor allem für Studienanfänger. Diese können Themen zum Zeitmanagement oder zur Stressbewältigung aber auch zu Entspannungsverfahren behandeln, sodass von Anfang an eine Unterstützung stattfindet (vgl. Kirsch et al. 2017: 187).
Weiterhin haben die Hochschulen die Möglichkeit durch (psychotherapeutische) Beratungsstellen den Studierenden eine niedrigschwellige Anlaufstelle zu bieten, bei der versucht wird Probleme zu lösen und weiterführende Informationen zur Verfügung zu stellen (vgl. Hofmann et al 2017: 401). Dabei kann eine individuelle Beratung für einen Einzelnen stattfinden, es können aber auch Thematiken in Gruppen besprochen werden (vgl. ebd.).
Die Ausführungen machen deutlich, dass es für die Hochschulen wichtig ist, dass sie das Gesundheitsbewusstsein der Studierenden stärken, eine gesundheitsfördernde Lernumgebung schaffen und bei dem verbesserten Gesundheitsverhalten von Studierenden unterstützend mitwirken.
Literatur:
Göring, A.; Möllenbeck, D. (2010): Gesundheitspotenziale des Hochschulsports. In: Prävention und Gesundheitsförderung. 2010/5. 238-242.
Hofmann, F.; Sperth, M.; Holm-Hadulla, R. (2017): Psychische Belastungen und Probleme Studierender. In: Psychotherapeut. 2017/62. 395-402.
Kirsch, A.; Laemmert, P.; Tittlbach, S. (2017): Gesundheitliche Anforderungen und Ressourcen von Studierenden. In: Prävention und Gesundheitsförderung. 2017/12. 181-188.
Thees, S.; Gobel, J.; Jose, G.; Bohrhardt, R.; Esch, T. (2012): Die Gesundheit von Studierenden im Bologna-Prozess. In: Prävention und Gesundheitsförderung.2012/7. 196-202.
Schizophrenie – die verschriene Krankheit
Geschrieben von
Angelika Kästner
Schizophrenie – ein Begriff, der nahezu jedem bekannt ist, doch nur die Wenigsten wissen, was sich dahinter verbirgt. Die Schizophrenie ist eine seelische Erkrankung, von der etwa jeder hundertste Mensch betroffen ist. (vgl. Finzen 2014, S. 251) Für Außenstehende und Laien stellt sie oft ein Rätsel dar. Ein Rätsel, das insbesondere in gesellschaftlichen Kontexten behaftet ist mit zahlreichen Vorurteilen, Stigmatisierungen, Angst, Faszination, Halbwissen und Unverständnis:
„Schizophrenie als Metapher wird ausschließlich abwertend gebraucht. Sie nährt Vorstellungen von Unberechenbarkeit und Gewalttätigkeit, von unverständlichem, bizarrem oder widersinnigem Verhalten und Denken. Ob Teenager etwas ‚schizo’ finden oder ob politisch Tätige das Handeln des Gegners als ‚schizophren’ brandmarken, macht da keinen Unterschied […] Die Schizophrenie ist eine unverstandene psychische Störung. Schizophrenie steht für Leiden, das Angst macht. Sie ist zudem die schillerndste aller psychischen Störungen. Schizophrenie ist gleichwohl – entgegen einem weitverbreiteten Vorurteil – eine zwar ernste, aber gut behandelbare Krankheit“ (ebd., S. 25, 27f.)
Im Alltagsgebrauch findet der Begriff Schizophrenie verstärkt Anwendung, wenn das Verhalten eines Menschen widersprüchlich erscheint (vgl. ebd. S. 27). So wird sie nicht selten verwechselt mit der dissoziativen Identitätsstörung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Persönlichkeit des Betroffen sich aufgrund traumatischer Erfahrungen und Verdrängungsmechanismen in unterschiedliche Rollen spaltet (vgl. Schlier & Lincoln 2014, S. 2972). Auch wird der Begriff Psychose oft gleichgesetzt mit der Schizophrenie (Clausen & Eichenbrenner 2010, S. 1883). Die Schizophrenie wird den Psychosen bzw. psychotischen Störungsbildern zugeordnet (vgl. Dümmler & Sennekamp 2013, S. 104). Auch die Manie, die bipolare Störung (manische Depressionen), Demenzen, schwere Depressionen und Delirien, die durch halluzinatorisches Erleben begleitet werden, gehören zu den Psychosen. Nicht selten spielt der Missbrauch von Drogen und Alkohol eine Rolle. Bei psychotischen Störungsbildern ist im Kern das Denken, Fühlen, Wollen, die Selbst- und die Fremdwahrnehmung beeinträchtigt. (vgl. Bäuml 2008, S. 2, 75; Clausen & Eichenbrenner 2010, S. 189f.)
Der Begriff Schizophrenie setzt sich zusammen aus den beiden griechischen Worteilen schizo (= Spaltung, abgespalten) und phren (= Seele). Übersetzt lässt sich unter dem Begriff eine „Spaltung der Seele“ (Bäuml 2008, S. 2) verstehen. Fakt ist, dass es sich hierbei nicht um eine Spaltung des Menschen in zwei Persönlichkeiten handelt, sondern um eine „Abspaltung der psychischen Funktionen“ (Clausen & Eichenbrenner 2010, S. 188). So ist die Erkrankung in erster Linie gekennzeichnet durch einen Realitätsverlust, eine Veränderung der allgemeinen Wahrnehmung und Verhaltensweisen. Der Betroffene lebt in einer eigenen Erfahrungswelt und nimmt Reizeinflüsse wahr, die für Außenstehende nicht nachvollziehbar sind. (vgl. Bandelow et al. 2013, S. 526; Clausen & Eichenbrenner 2010, S. 190) Bäuml spricht in diesem Zusammenhang von einer Spaltung der Wahrnehmung in die allgemeine und die private Wirklichkeit (vgl. Bäuml 2008, S. 2). Neben den Trugwahrnehmungen und Sinnestäuschungen, die durch eine nachweisliche Fehlstörung des Neurotransmittersystems im menschlichen Gehirn ausgelöst werden, wird die Schizophrenie, je nach Krankheitsphase, unter anderem begleitet durch affektive Störungen, sozialen Rückzug, Denkstörungen, Interessensverlust, sprachliche Verarmung, psychomotorische Störungen und einer Antriebslosigkeit. (vgl. ebd., S. 15; Finzen 2014, S. 77ff.; Tölle & Windgassen 2014, S. 189ff.)
Neben einer klinischen, medizinisch-therapeutischen Behandlung, ist heute die Soziale Arbeit nicht mehr weg zu denken. Sozialpsychiatrische Maßnahmen wie z. B. ambulant betreute Wohnformen spielen eine unweigerlich wesentliche Rolle, um Begleiterscheinungen wie soziale Isolationen (die häufig die Folge von Stigmatisierungsprozessen ist) und Einschränkungen in der alltäglichen Lebensführung auszugleichen. (vgl. Clausen & Eichenbrenner 2010, S. 75; Dümmler & Sennekamp 2013, S. 15f.; Finzen 2014, S. 157)
1 Finzen, Asmus (2014): Schizophrenie – Die Krankheit verstehen, behandeln, bewältigen. 2. Auflage. Psychiatrie Verlag. Köln
2 Schlier, Björn & Lincoln, Tania M. (2014): „Bluttaten“ und „schizophrene Politik“ – Stigmatisierung von Schizophrenie in 4 großen deutschen Printmedien aus dem Jahr 2011. In: Psychotherapeut 4. Springerverlag. Berlin/Heidelberg
3 Clausen, Jens & Eichenbrenner, Ilse (2010): Soziale Psychiatrie – Grundlagen, Zielgruppen, Hilfeformen. Kohlhammerverlag. Stuttgart
4 Dümmler, Wiltrud & Sennekamp, Winfried (2013): Recovery im psychiatrischen Wohnheim – Chancen und Grenzen des Konzepts bei Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung. Centaurus Verlag & Media UG. Freiburg
5 Bäuml, Josef (2008): Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis. 2. Auflage. Springerverlag. Heidelberg
6 Bandelau, Borwi; Falkai, Peter & Gruber, Oliver (2012): Kurzlehrbuch Psychiatrie. 2. Auflage. Springerverlag. Göttingen
Arbeiten bis die Seele brennt - Was hat es mit dem Burnout auf sich?
Geschrieben von
Imke Dörnath
Burnout heißt ins Deutsche übersetzt ausbrennen und bedeutet ‚leer werden‘. „Die eigenen körperlichen und seelischen Reserven erschöpfen“ (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. 2014: 25). Geprägt wurde der Begriff in den 1970er Jahren durch den deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker H. Freudenberger, der in einer Forschung Krankheitssymptome mit dem Begriff Burnout verknüpft hat. (Sisolefsky et al. 2017: 6) Heute gibt es kaum einen Menschen, der nicht etwas mit diesem Wort verbindet. Burnout wird in Zusammenhang mit den wandelnden Lebensbedingungen und beruflichen Beanspruchungen gebracht (vgl. Berger 2013: 789). Menschen müssen mehr denn je die Strukturierung und Organisierung des Lebens selbst in die Hand nehmen. Der Konkurrenz-, Leistungs- und Erfolgsdruck steigt (Brühlmann 2015: 14). Der ‚Markt der Möglichkeiten‘ wächst stetig, vor allem bei der Flexibilisierung der Arbeitswelt. Moderne Arbeitsbedingungen, wie der Zugriff auf betriebliche Surver rund um die Uhr von zu Hause aus, die Informationsweitergabe durch das Verschicken von E-Mails und die vielen Funktionen des Smartphones, stellen hohe Anforderungen an das Selbstmanagement der Menschen. Für die richtige Balance zwischen Arbeit und Freizeit sind die modernen Arbeitsbedingungen also Segen und Fluch zugleich. Sie eröffnen große Chancen für ein selbstbestimmtes Arbeiten, stellen parallel dazu aber eine Gefahr für Überarbeitung, Selbstausbeutung und somit die eigene Gesundheit dar. Die Abgrenzung von Arbeitszeit und Freizeit fällt durch ‚home office‘ schwerer und verleitet zu überlangen Arbeitszeiten (Gündel et al. 2014: 154). Überlange Arbeitszeiten und der enge Zeitplan während der Arbeitszeit werden in Kauf genommen, weil die Mehrheit unserer Gesellschaft ein gelungenes Leben über die berufliche Anerkennung gepaart mit der finanziellen Situation definiert. Das kann sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken. Doch nicht alle Menschen erleben per se eine psychische Erschöpfung durch den Wandel der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Was für die eine Person als entkräftend wahrgenommen wird, kann für eine andere Person noch völlig in Ordnung sein. Psychische Belastungen, die Burnout hervorrufen, lassen sich nicht objektivieren (Hofmann 2015: 17). Es ist eine Kombination aus persönlichen Einstellungen, aktuellen Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen, die zu Burnout führen kann (Gündel et al. 2014: 140). Personen, die hohe Ansprüche an sich selbst stellen, beruflich viel erreichen möchten und bereit sind dafür an ihre persönlichen Grenzen zu stoßen, sind sehr empfänglich für Burnout. Häufig schaffen sie es ab einem gewissen Punkt nicht mehr auf ihren Körper zu hören um sich abzugrenzen. Das führt dann zu einer langanhaltenden Überforderung und löst hohen Stress aus (Gündel et al. 2014: 140). Die Kernsymptome vom Burnout-Prozess lassen sich in drei Phasen einteilen. Anfänglich sind die Erwartungen an das eigene Arbeitspensum so hoch, dass sie kaum realisierbar sind. Gefühle des Ausgelaugt sein treten ein. Darauf folgt in der zweiten Phase das gesteigerte Bemühen, die Ziele mit vollstem Einsatz doch irgendwie zu erreichen, um nicht zu scheitern. Das kostet sehr viel Kraft und führt zum sozialen Rückzug und damit zur Vermeidung sozialer Kontakte. Letztlich wird der Person bewusst, dass die Ziele trotz vollem Einsatz der eigenen Kräfte nicht zu erreichen sind. Das ist frustrierend und löst Empfindungen der Erfolgs- und Machtlosigkeit aus. Der anfangs noch überausgeprägte Tatendrang entwickelt sich durch die eben beschriebenen Erfahrungen zur Gleichgültigkeit. (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. 2014: 27). Die psychische Erschöpfung ist so hoch, dass die alltägliche Arbeit nicht mehr erfolgreich bewältigt werden kann und die Leistungsfähigkeit immer weiter sinkt (Sisolefsky et al. 2017: 7). Damit ist auch häufig der Verlust des Lebenssinns verbunden. Betroffene Personen merken meist erst sehr spät, dass sie sich mit ihrer Arbeitsmotivation und ihrem überhöhten Ehrgeiz überfordern (Gündel et al. 2014: 136).
Burnout ist also ein sich langsam entwickelnder Prozess. Es ist aber keine eigenständige Krankheit (Hofmann 2015: 13). Die „Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde“ hat Burnout als „Risikozustand für psychische und somatische Erkrankungen durch Arbeitsüberlastung“ festgelegt (Berger 2013: 789). Das ist aber keine allgemeingültige Definition. Wie eingangs beschrieben, wird Burnout sehr subjektiv empfunden und muss immer individuell betrachtet werden. Burnout kann den Gesundheitszustand beeinflussen und das Entstehen und Aufrechterhalten von Krankheiten fördern (Hofmann 2015: 10).
Um gesund und leistungsfähig zu bleiben lohnt es sich auf die Grenzen des eigenen Körpers zu hören, auch mal nein zu sagen und sich regelmäßige Pausen zu gönnen.
Literatur:
Berger, M (2013): Burnout. In: Nervenarzt, Volume 84, S. 789-790, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag
Brühlmann, T. (2015): Burnout – Stressverarbeitungsstörung und Lebenssinnkrise. In: Göbel, H./Sabatowski, R. (Hrsg.): Weiterbildung Schmerzmedizin. CME-Beiträge aus: Der Schmerz 2013-2014, S. 11-22, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag
Gündel, H./Gläser, J./Angerer, P. (2014): Arbeiten und gesund bleiben. K.O. durch den Job oder fit im Beruf, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag
Hofmann, E.(2015): Wo brennt es beim Burnout? Eine passungspräventive Sichtweise zur Analyse und Vermeidung von Burnout, Wiesbaden: Springer Fachmedien
Sisolefsky, F./Rana, M./Herzberg, P.Y. (2017): Persönlichkeit, Burnout und Work Engagement. Eine Einführung für Psychotherapeuten und Angehörige gefährdeter Berufsgruppen, Wiesbaden: Springer Fachmedien
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (Hrsg.) (2014): Psychische Belastungen und Burnout beim Bildungspersonal. Empfehlungen zur Kompetenz- und Organisationsentwicklung, Münster: Waxmann Verlag GmbH
Einsame Internetjugend?
Geschrieben von
Sandra Wagner
Jugend wird in der Gesellschaft gerne mit Vitalität, Gedeihen, Aktivität, Attraktivität und Geselligkeit assoziiert. Umso bemerkenswerter ist das Ergebnis der Studie „Wie einsam ist Deutschland?“, wonach sich 20 % der 16-30-Jährigen stark einsam fühlen (Wahlverwandtschaften/Harris Interactive 2015: o. S.). Unter Einsamkeit wird „das negative individuelle Erleben unzureichender Sozialkontakte“ verstanden (Lauth/Viebahn 1987: 11). Einsamkeit in Zeiten, wo Internet beziehungsweise Social Media eine Selbstverständlichkeit darstellen? Oder macht gerade die Onlinewelt einsam? Kritischen Stimmen zufolge gleicht das Internet einem Virus, der sich negativ auf die Intelligenz und das Sozialverhalten von (nicht nur) jungen Menschen auswirkt. Aber: „Die populärwissenschaftlichen Mythen stimmen in vielen Fällen nicht mit dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand überein.“ (Appel 2016: 62). In einem Interview weist Appel vom Institut für Kommunikationspsychologie und Medienpädagogik an der Universität Koblenz-Landau auf eine Metaanalyse von Huang (2010) hin, die zeigt, dass „im Durschnitt kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Internetnutzung und Einsamkeit“ besteht (ebd.: 63). Im Gegenteil: Wenn Personen sich bereits im realen Leben kennen und dort ebenfalls begegnen oder zuvor begegnet sind, können E-Mails, Chats etc. dazu beitragen, den Kontakt zu vertiefen oder zu erhalten (vgl. ebd.). Beispiele hierfür sind der alte Schulfreund, der in eine andere Stadt verzogen ist, oder die Cousine, die nach Australien ausgewandert ist. Heutzutage bedeutet das nicht mehr automatisch das Aus der Verbindung, sondern stellen Vernetzungen Alternativen dar, um buchstäbliche Entfernungen – und damit auch mögliche Einsamkeitsgefühle – zu verhindern. Anders verhält es sich, wenn Jugendliche sich in Foren als stille Mitleser*innen, sprich passiv, verhalten und/oder sich bereits einsam fühlen. Das Eintauchen in die Welt der aktiven Social Media-Nutzer*innen kann dann das eigene Einsamkeitsgefühl wecken oder verstärken, denn „im Vergleich zu anderen nimmt man sich selbst als weniger integriert wahr (zu wenige Freunde, zu wenige intensiv gelebte Freundschaften)“ (Appel 2016: 64). Ursache hierfür ist dann nicht das Internet, sondern eine eingeschränkte Integrationsfähigkeit oder -möglichkeit. Das Internet pauschal als Wegweiser in die Isolation zu verurteilen, ohne gleichzeitig einen Blick auf das Nutzungs- und Nutzerverhalten sowie die Lebensumstände der Nutzer*innen zu werfen, wäre daher irrig.
Literatur:
Appel, M. (2016): „Immer online, immer allein?“- Zu den Auswirkungen des digitalen Wandels. In: Lenhard, W. (Hrsg.): Psychische Störungen bei Jugendlichen. Ausgewählte Phänomene und Determinanten. Berlin und Heidelberg, S. 57-65
Lauth G./Viebahn, P. (1987): Soziale Isolierung. Ursachen und Interventionsmöglichkeiten. München und Weinheim
Wahlverwandtschaften/Interactive Harris (2014): Einsamkeit & Gemeinsamkeit in Deutschland. Eine Studie von Harris Interactive und Wahlverwandtschaften e. V. Online verfügbar unter: www.wahlverwandtschaften.org/images/dateien/downloads/Einsamkeit_in_Deutschland_2015-04-01final.pdf [09.12.17]