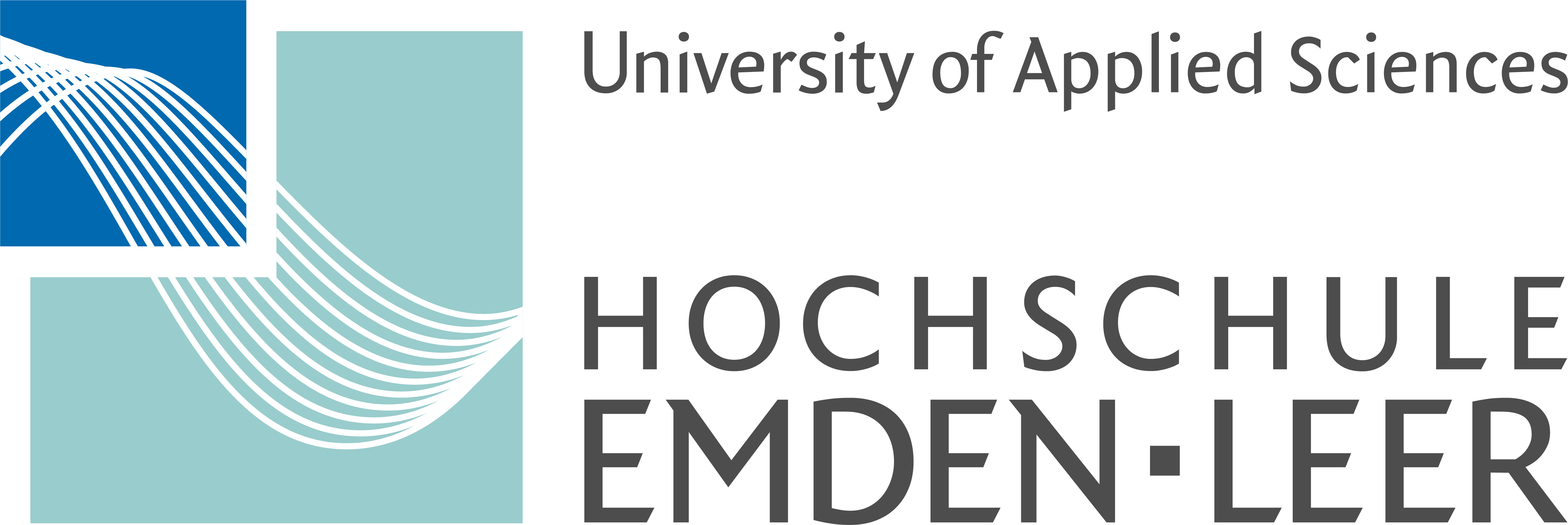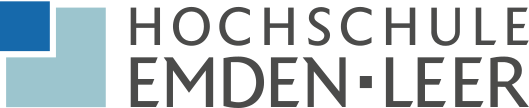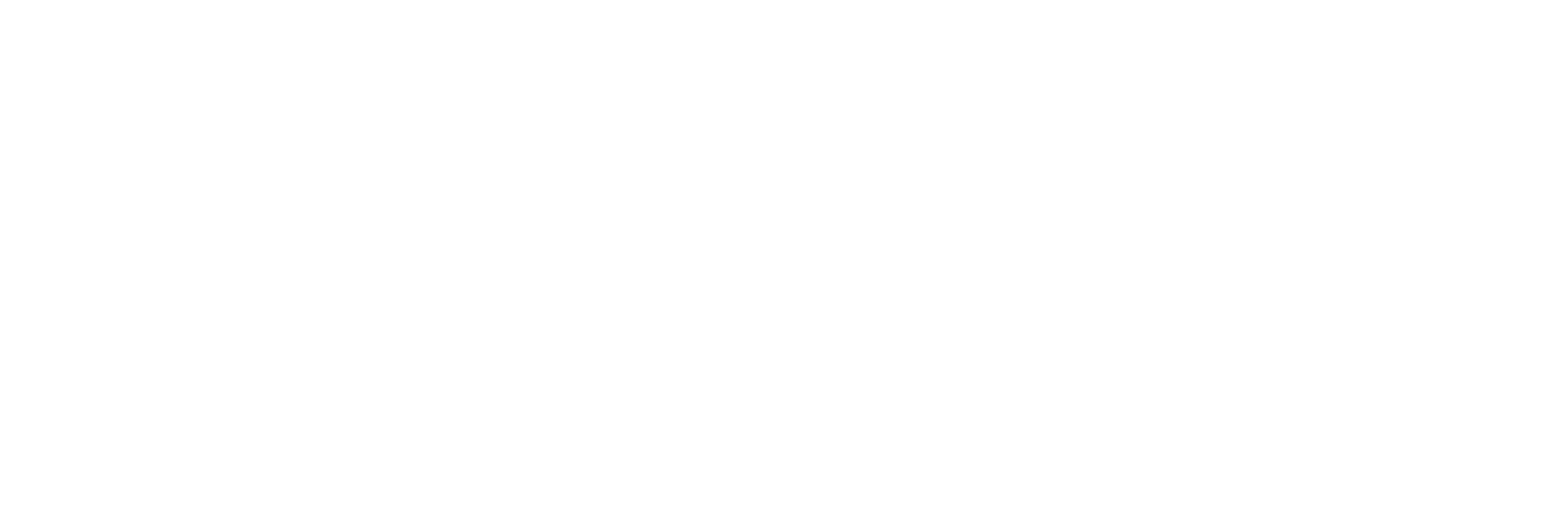DE
|
EN
-
Studieninteressierte
-
Studierende
-
Fachbereiche
-
Seefahrt und Maritime Wissenschaften
-
Soziale Arbeit und Gesundheit
- Blick in den Fachbereich
- Kontakt
- Erstsemesterinformationen
- International
-
Forschung
- Institute
- Gremien
-
Projekte
- COVID
- EBBiK - Entwicklung von Bildfähigkeit als Bildungsauftrag
- Familienzentrum Aurich (FamZ)
- Kombi-Nord
- Kommunale Suchtprävention in der Satdt Delmenhorst
- Kommunales Teilhabekonzept für die Stadt Emden
- REFU
- Sociotechnical Practices of Objectivation
- Suchtpräventionskonzept des Landes Niedersachsen
- Suchtprävention in Schulen (SiS)
- Wer nicht fragt, geht offline: Kids as digital citizens
- Werkstatt für Praxisforschung
- WOGO
- WOGE
-
Team und Termine
- Hilfen zum Studium
- Praxisreferat
-
Studiengänge
-
Technik
- Aktuelles
- Kontakt
- Studieren
- Forschung
-
Projekte
-
Labore im Fachbereich Technik
- Additive Fertigung
- Denkraum
- Designlabor
- FabLab - Labor für studentische Projekte
- Automatisierungssysteme
- Bioverfahrenstechnik
- Biochemie/Molekulare Genetik
- Innovationen im Ingenieurwesen
- Instrumentelle Analytik
- Intelligente Produktionssysteme
- Kolbenmaschinen
- Maschinendynamik
- Leichtbaulabor
- Maschinenelemente
- Mechatronik
- Mikrobiologie
- Organische Chemie
- Physikalische Chemie
- Polymere
- Produktionsplanung
- Produktionstechnik
- Rechnernetze
- Regelungstechnik
- Regenerative Energien
- Labor S4
- Technische Informatik
- Verfahrenstechnik
- Werkstoffkunde, Laser- und Fügetechnik
- Wind - und Solarenergie
- Zellkulturtechnik
- Forschung / Institute
- Unser Fachbereich
-
Studiengänge
- Applied Life Sciences
- Biotechnologie
- Biotechnologie im Praxisverbund
- Business Intelligence and Data Analytics (Master)
- Chemietechnik/Umwelttechnik
- Chemietechnik im Praxisverbund
- Elektrotechnik
- Elektrotechnik im Praxisverbund
- Engineering Physics
- Engineering Physics (Master)
- Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
- Industrial Informatics (Master)
- Informatik
- Informatik im Praxisverbund
- Maschinenbau und Design
- Maschinenbau und Design im Praxisverbund
- Maschinenbau (Master)
- Medieninformatik (Online)
- Medieninformatik (Online, Master)
- Medientechnik
- Nachhaltige Produktentwicklung im Maschinenbau
- Nachhaltige Prozesstechnologie
- Nachhaltige Prozesstechnologie (PV)
- Wirtschaftsinformatik (Online)
- Regenerative Energien (Online)
- Technical Management (Master)
- Technology of Circular Economy (Master)
- Internationaler Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
- Wirtschaftsingenieurwesen – Engineering & Management
-
Wirtschaft
- Modulhandbücher, Ordnungen & Vorleistungen
- Aktuelles, Termine & Informationen zum SoSe 25
- Projekte & Forschung
-
Studiengänge
- Business Management (M. A.)
- Energy & Sustainability Management (B. Sc.)
- Digital Management (B. Sc.)
- Business Management - BWL (B. A.)
- International Business & Culture (B. A.)
- Betriebswirtschaft dual (B.A.)
- Betriebswirtschaft (B. A.)
- Wirtschaftspsychologie (B. A.)
- International Business Administration (B. A.)
- Advanced Management berufsbegleitend (M. Sc.)
- Advanced Management Stipendium
- Management Consulting (M. A.)
- Wirtschaftsinformatik Online (M. Sc.)
- Das Team vom FB Wirtschaft
- Erstsemester & Studieninteressierte
- Absolvierende & Alumni
-
Im Studium
-
Auslandsbüro
- Erasmus+ Partnerhochschulen
- Außereuropäische Partnerhochschulen
- Voraussetzungen und Vorbereitung
- Bewerbung ERASMUS+ Partnerhochschulen
- Bewerbung außereuropäische Partnerhochschulen
- Anerkennung von Leistungen aus dem Ausland
- Finanzielle Unterstützung
- Erfahrungsberichte
- Bewerbung Incomings
- English Programme
- FAQ
- Praxisphase
- Anträge/Formulare Prüfungskommission
- Servicebüro
- Software-Tool für Studierende
-
Auslandsbüro
- Informationen für Schulen
-
Seefahrt und Maritime Wissenschaften
- Studium
- Service-Einrichtungen
- Beratung für Studierende
-
Campusleben
-
Fachbereiche
-
QuickLinks
-
Hochschule
-
Für Unternehmen
- Region im Fokus
-
Zentrum für Weiterbildung
- Übersicht
-
Weiterbildungen
- Burnout-Prophylaxe
- Cybercrime
- Gamification für Businesstransformation
- Business Basics for School
- Sustain 2030
- Lean Management
- „Nordbeat–der Norden macht Zukunft:Tag der Weiterbildung
- Business 2 Business - 5.0
- Betrieblicher Gesundheitsmanager in BPS
- Programmieren mit Scratch
- Cyber-Security Hacking Training
- Konfiguration mit Sidekick -Humanisierung der KI
- Kommunikation, Wertschätzung und Selbstmanagement
- Konflikt-Kommunikation
- Kommunikation und Gesprächsführung:Konflikt-Kommunikation
- Kommunikation & Zusammenarbeit
- Humor in der Beratung
- Kundenzentrierung-Customer Centricity für KMU & Start-UP
- Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Gewaltfreie Kommunikation
- Casemanagement im Praxisalltag
- Trauma-Pädagogik
- Reflexionstag
- Outdoor-Erlebnis
- Finance for non-finance
- Management-Essentials: Gamification für BWL-Einsteigende
- Marketing Praxiswerkstatt
- Software Development
- Einführung in die Produktionstechnologie
- Traumaberatung
- Systemische Beratung und Coaching
- Windenergie-Nutzung
-
Organisation
-
Einrichtungen A-Z
- Arbeitssicherheit
-
Bibliothek
-
CampusDidaktik
- Career Service
- Datenschutz
- Finanzabteilung
- Gebäudemanagement
-
Gleichstellungsstelle
- Hochschulplanung und Qualitätssicherung
- health & sports
-
Immatrikulations- und Prüfungsamt
-
International Office
- Kommunikation und Hochschulkultur
- MeerCommunity Startup Center
-
Nachhaltigkeit
- Ombudswesen
-
Personalabteilung
- Personalrat
- Präsidialbüro/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Rechenzentrum
- Sprachenzentrum
- Studium Generale
- MyCampus
- Wissens- und Technologietransfer
-
Zentrale Studienberatung
- Betriebsgruppe ver.di
- Zentrum für Weiterbildung
- Karriere
- Präsidium
- Veranstaltungen
- Leitbild
- Organigramm
- Zahlen, Daten und Fakten
-
Ordnungen, Richtlinien, Verkündungsblätter
- Ordnungen und Richtlinien
-
Ordnungen für Studiengänge
- Advanced Management
- Applied Life Sciences
- Betriebswirtschaft
- Betriebswirtschaft (dual)
- Biotechnologie/Bioinformatik
- Biotechnologie
- Biotechnologie im Praxisverbund
- Business Administration (dual)
- Business Intelligence and Data Analytics
- Business Management
- Business Management (Bachelor)
- Chemietechnik/Umwelttechnik
- Chemietechnik im Praxisverbund
- Digital Management
- Elektrotechnik
- Elektrotechnik im Praxisverbund
- Elektrotechnik und Automatisierungstechnik
- Energieeffizienz
- Energy and Sustainability Management
- Engineering Physics (Bachelor)
- Engineering Physics im Praxisverbund
- Engineering Physics (Master)
- Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
- Industrial Informatics
- Informatik
- Informatik im Praxisverbund
- Inklusive Frühpädagogik
- Interdisziplinäre Physiotherapie/Motologie/Ergotherapie
- International Business Administration
- Internationaler Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (IBS)
- International Business and Culture
- Kindheitspädagogik
- Lasertechnik
- Management Consulting
- Maritime Operations
- Maritime Technology and Shipping Management
- Maschinenbau
- Maschinenbau und Design
- Maschinenbau und Design für Berufsqualifizierte
- Maschinenbau und Design im Praxisverbund
- Medientechnik
- Nachhaltige Produktentwicklung im Maschinenbau
- Nachhaltige Prozesstechnologie
- Nachhaltige Prozesstechnologie im Praxisverbund
- Nautik
- Nautik und Seeverkehr
- Online-Bachelorstudiengang Medieninformatik (Voll-/Teilzeit)
- Online-Masterstudiengang Medieninformatik (Voll-/Teilzeit)
- Online-Bachelorstudiengang Regenerative Energien
- Online-Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (Voll-/Teilzeit)
- Online-Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik
- Physiotherapie
- Schiffs- und Reedereimanagement
- Soziale Arbeit
- Soziale Arbeit (BASA-online)
- Soziale Arbeit und Gesundheit im Kontext sozialer Kohäsion (Vollzeit/Teilzeit)
- Soziale Kohäsion im Kontext Sozialer Arbeit u. Gesundheit
- Sozial- und Gesundheitsmanagement
- Sozialmanagement
- Sustainable Energy Systems
- Technical Management
- Technology of Circular Economy
- Wirtschaftsinformatik (Dual)
- Wirtschaftsingenieurwesen Maritime Wissenschaften (B.Sc.)
- Wirtschaftsingenieurwesen - Engineering & Management
- Wirtschaftspsychologie
- Verkündungsblätter
- Gremien
- Beauftragte
- Hochschulwahlen
-
Einrichtungen A-Z
- Studienorte
-
Für Unternehmen
-
Forschung
-
Forschungsprofil
- Forschungs- und Transferstrategie
- Forschungsschwerpunkte
-
Forschende
- Seefahrt und Maritime Wissenschaften
- Soziale Arbeit und Gesundheit
-
Wirtschaft
- Prof. Dr. Knut Henkel
- Prof. Dr. Tom Koch
- Prof Dr. Ute Gündling
- Prof Dr. Annika Wolf
- Prof. Dr. Jan Handzlik
- Prof. Dr. Hans-Gert Vogel
- Prof. Dr. Till Becker
- Prof. Dr. Henning Hummels
- Prof. Dr. Thomas Lenz
- Prof. Dr. Wolfgang Portisch
- Prof. Dr. Jan Christopher Pries
- Prof. Dr. Ute Rademacher
- Prof. Dr. Marco Rimkus
- Prof. Dr. Eva-Maria Schön
- Prof. Dr. Joachim Schwarz
- Technik - Elektrotechnik + Informatik
- Technik - Maschinenbau
-
Technik - Naturwissenschaftliche Technik
- Prof. Dr. Gerhard Illing
- Prof. Dr. Gottfried Walker
- Prof. Dr. Ingo de Vries
- Prof. Dr. Mark Rüsch gen. Klaas
- Prof. Dr. Jens Hüppmeier
- Prof. Dr. Iván Herráez
- Prof. Dr. Ralf Habermann
- Dr. Julia Jessica Reimer
- Prof. Dr. Claudia Gallert
- Prof. Dr.-Ing. Philipp Huke
- Prof. Dr. Martin Silies
- Prof. Dr. Martin Sohn
- Prof. Dr. Sven Steinigeweg
- Prof. Dr. habil. Ulrich Teubner
- Folgeabschätzung und Ethik
- Promotionen
- Leitbild Existenzgründung
- Nachhaltigkeit in der Forschung
-
Projekte
-
Aktuelle Projekte
- Adaptive Fortbildungen in der medienpädagogischen Altenbi
- AnkerPROF
- Biotech Talent Unlocked
- BUFFER+
- CargoTube operation facility
- EARLY
- Entwicklung eines Reinigungsroboters für Offshore-WKA
- FlettnerFLEET
- GE-VORS
- GG-Check
- HyLab
- Hyper4Rail
- InnoWerft
- Integrierte und innovative maritime Technologien für Mobi
- Kipti
- MAVERIC 5G
- Meer-O - Mehr Entrepreneurinnen für Emden und die Region
- MeerCommunity
- MIINTER
- Nordwest Niedersachsen Nachhaltig Neu (4N)
- PANTHER
- Professorinnenprogramm III
- ProlOg
- RASANT
- ReqET
- SIoT-Gateway
- SoWeKi
- Standardisierung, Weiterentwicklung und Kommunikation von
- tubLANQ.0
- Transferzentrum für Nachhaltige Mobilität
- TwinMaP
- WaddenVision
- Wissenschaftliche Begleitung Strukturwandel Ostfriesland
- Zukunftslabor Produktion
- Projekte nach Bereichen
- Beendete Projekte
-
Aktuelle Projekte
-
Forschungseinrichtungen
- Promotionskollegien
-
Institute
-
Netzwerke
- Nationalpark Wattenmeer
- Promotionsnetzwerk Emden/Leer
- Digital Hub Ostfriesland (DHO)
- Tötungshandlungen in Einrichtungen des Gesundheitswesens
- Wachstumsregion Emsachse
- Maritimes Kompetenzzentrum (Mariko)
- greentech Ostfriesland
- NorShiP-Research School
- Association of Schools of Public Health
- Hochschulen für Gesundheit
- Deutsche Gesellschaft für Public Health
- Powerhouse Nord
- GENDERnet
- Einrichtungen in den Fachbereichen
-
Beratung
-
Forschungsprofil
Gruppengröße
Empfohlene Größen
Für Diskussionen und Projektarbeiten: 3-5 Studierende (genug, um verschiedene Perspektiven zu integrieren, aber nicht zu groß, damit niemand „untergeht“)
Für umfangreiche Aufgaben (z.B. Forschungsprojekte oder semesterlange Projekte): 5-7 Studierende sind denkbar, allerdings steigt dann der Koordinationsaufwand und die Gefahr des „Social Loafing“ (Trittbrettfahrer*innen)
Auswirkungen der Gruppengrößen
Kleine Gruppen: Höhere Interaktionsfrequenz, intensiveres Teamgefühl, individuelle Verantwortungsübernahme ist klarer. Schnelle Entscheidungsfindung (geringer Abstimmungsaufwand)
Größere Gruppen: Stärkere Aufgabenteilung möglich, aber potenziell mehr Konflikte und höhere Moderationsbedürftigkeit
Einteilungsmöglichkeiten
| Vorteile |
|
| Nachteile |
|
| Potenzielle Belastungen |
|
| Wann sinnvoll? |
|
| Vorteile |
|
| Nachteile |
|
| Potenzielle Belastungen |
|
| Wann sinnvoll? |
|
| Vorteile |
|
| Nachteile |
|
| Pozenzielle Belastungen |
|
| Wann sinnvoll? |
|
| Konzept |
| |
| Homogen | Vorteile |
|
| Nachteile |
| |
| Heterogen | Vorteile |
|
| Nachteile |
| |
| Potenzielle Belastungen |
| |
| Wann sinnvoll? |
|
| Konzept |
|
| Vorteile |
|
| Nachteile |
|
| Potenzielle Belastungen |
|
| Wann sinnvoll |
|