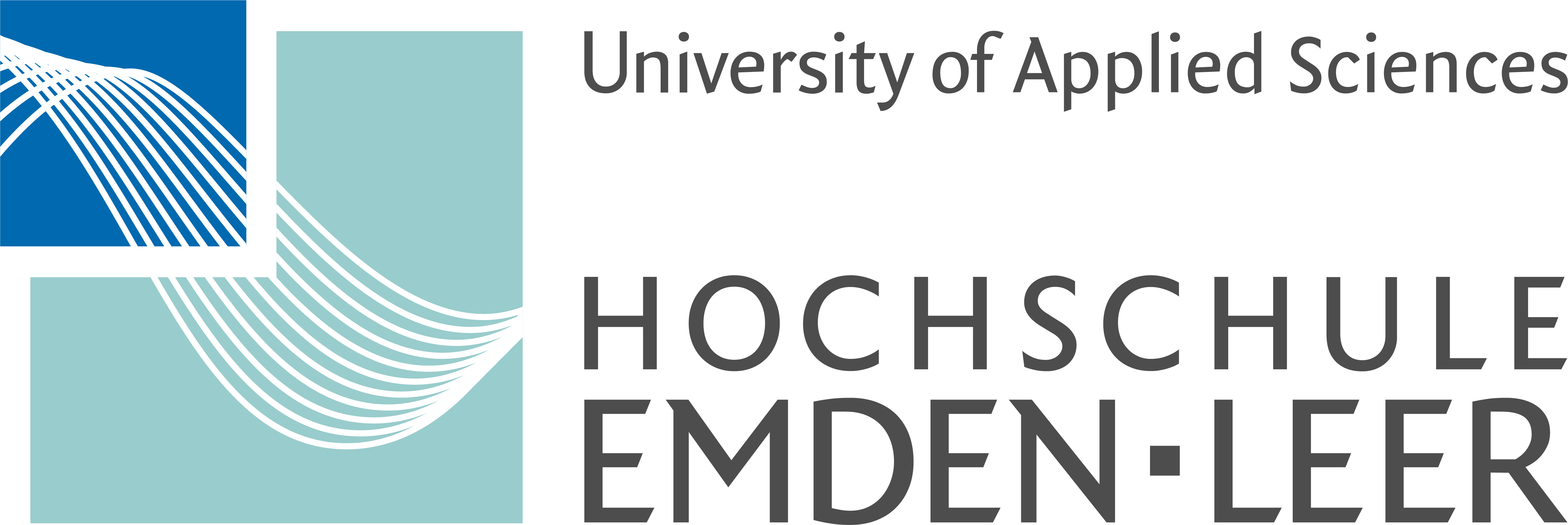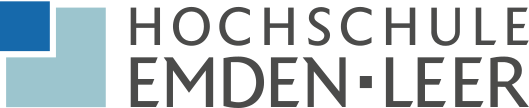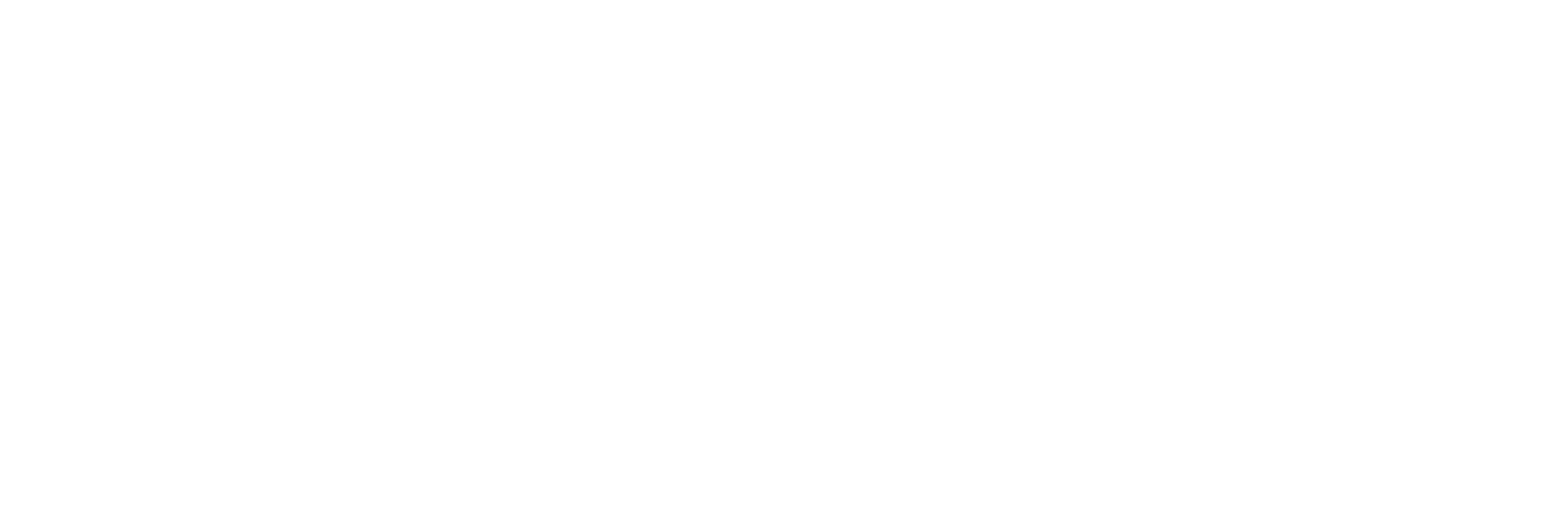-
Prospective Students
-
Current Students
-
Faculties
-
Maritime Sciences
-
Social Work and Health
- Insight the Faculty
- Contact
- Erstsemesterinformationen
-
Internationales
-
Forschung
- Institute
- Laboratory
-
Projects
- COVID
- EBBiK - Entwicklung von Bildfähigkeit als Bildungsauftrag
- Familienzentrum Aurich (FamZ)
- Kombi-Nord
- Kommunale Suchtprävention in der Satdt Delmenhorst
- Kommunales Teilhabekonzept für die Stadt Emden
- REFU
- Sociotechnical Practices of Objectivation
- SoWeKi
- Suchtpräventionskonzept des Landes Niedersachsen
- Suchtprävention in Schulen (SiS)
- Wer nicht fragt, geht offline: Kids as digital citizens
- Werkstatt für Praxisforschung
- WOGO
- WOGE
-
Team
- Hilfen zum Studium
- Praxisreferat
-
Study Programs Social Work and Health
-
Technology
- Current topics
- Contact
- Study
- Research
-
Projects
-
Cyber-Security-Lab
- Additive Fertigung
- Denkraum
- Designlabor
- FabLab - Labor für studentische Projekte
- Automation Systems
- Bioverfahrenstechnik
- Biochemie/Molekulare Genetik
- Innovationen im Ingenieurwesen
- Instrumentelle Analytik
- Intelligente Produktionssysteme
- Kolbenmaschinen
- Machine dynamics
- Leichtbaulabor
- Maschinenelemente
- Mechatronik
- Mikrobiologie
- Organische Chemie/Nachwachsende Rohstoffe
- Physikalische Chemie
- Polymere
- Lab for production planning
- Produktionstechnik
- Networked Systems
- Regelungstechnik
- Labor S4
- Technische Informatik
- Verfahrenstechnik
- Werkstoffkunde, Laser- und Fügetechnik
- wind energy lab
- Zellkulturtechnik
- IT-Sec-Lab
- Research / Institutes
- Insight the Faculty
-
Study Programs
- Applied Life Sciences (Master)
- Biotechnology
- Biotechnologie im Praxisverbund
- Business Intelligence and Data Analytics
- Chemical Engineering/Environmental Technology
- Chemietechnik im Praxisverbund
- Electrical Engineering
- Electrical Engineering (Dual Study)
- Engineering Physics
- Engineering Physics (Master)
- Renewable Energy and Energy Efficiency
- Industrial Informatics (Master)
- Computer Science
- Computer Science (Dual Study)
- Mechanical Engineering and Industrial Design
- Mechanical Engineering and Industrial Design (dual degree course)
- Mechanical Engineering (Master)
- Medieninformatik (Online)
- Medieninformatik (Online, Master)
- Media Technology
- New study program page NaPriMa
- Nachhaltige Prozesstechnologie
- Nachhaltige Prozesstechnologie (PV)
- Wirtschaftsinformatik (Online)
- Regenerative Energien (Online)
- Technical Management
- Technology of Circular Economy
- Computer Science and Economics
- Wirtschaftsingenieurwesen – Engineering & Management
-
Business Studies
- Module manuals, regulations & preliminary work
- News, dates & information about the current semester
- Projects & Research
-
Courses of studies
- Business Management (M. A.)
- Energy & Sustainability Management (B. Sc.)
- Digital Management (B. Sc.)
- Business Management - BWL (B. A.)
- International Business & Culture (B. A.)
- Betriebswirtschaft dual (B.A.)
- Business Studies (B. A.)
- business psychology
- International Business Administration (B.A. )
- Advanced Management berufsbegleitend (M. Sc.)
- Advanced Management Stipendium
- Management Consulting (M.A.)
- Business Informatics (Online)
- Team
- Before your studies
- Graduates & Alumni
-
Auslandsbüro
- In studies
- Information for schools
-
Maritime Sciences
- Studium
- Services
- International campus
-
Life on campus
-
Faculties
-
QuickLinks
-
University of Applied Sciences
- Für Unternehmen
-
Centre for further education
- Übersicht
-
Weiterbildungen
- Burnout-Prophylaxe
- Cybercrime
- Gamification für Businesstransformation
- Business Basics for School
- Sustain 2030
- Lean Management
- „Nordbeat–der Norden macht Zukunft:Tag der Weiterbildung
- Business 2 Business - 5.0
- Betrieblicher Gesundheitsmanager in BPS
- Programmieren mit Scratch
- Cyber-Security Hacking Training
- Konfiguration mit Sidekick -Humanisierung der KI
- Kommunikation, Wertschätzung und Selbstmanagement
- Konflikt-Kommunikation
- Kommunikation und Gesprächsführung:Konflikt-Kommunikation
- Kommunikation & Zusammenarbeit
- Humor in der Beratung
- Kundenzentrierung-Customer Centricity für KMU & Start-UP
- Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Gewaltfreie Kommunikation
- Casemanagement im Praxisalltag
- Trauma-Pädagogik
- Reflexionstag
- Outdoor-Erlebnis
- Finance for non-finance
- Management-Essentials: Gamification für BWL-Einsteigende
- Marketing Praxiswerkstatt
- Software Development
- Nachhaltige Führungskräfteentwicklung
- Agile Frameworks I
- Einführung in die Produktionstechnologie
- Traumaberatung
- Systemische Beratung und Coaching
- Windenergie-Nutzung
- The region in focus
- press
-
Organization
-
Departments A-Z
- Workplace Safety
-
University Library
-
CampusDidaktik
- Team CampusDidaktik
- Tag der Lehre
- Q&A
- Positionspapiere
- Tools für Lehre und Zusammenarbeit
- Moodle
- Impulse und Inspiration für die Lehre
- Kleingruppenarbeit begleiten
- Urheberrecht in der Lehre
- KI in der Hochschullehre
- Hybride Lehre
- Barrierefreiheit in der Lehre
- Planspielzentrum
- Digitale Prüfungen
- Institut für projektorientierte Lehre (Ipro-L)
- Didaktische Beratung
- Career Service
- Datenschutz
- Finanzabteilung
- Gebäudemanagement
-
Gleichstellungsstelle
- Planning and Quality Assurance
- health & sports
-
Admission and Examination Office
-
International Office
- Your way abroad
-
International Students
- German Classes
- FAQ incoming students
- degree-seeking students
- Exchange Students / ERASMUS+
- Housing
- Buddy-Program for International Students
- International Sustainability Program
- Living Expenses
- Scholarships
- Visa
- Health Insurance and Co.
- Studying with Impairment (Inclusion and Accessibility)
- Internships & Jobmarket
- Event notes
- Internationalization at home university
- Partner Universities
- Staff Mobility
- Contact & Download Area
- Allgemeines über das ERASMUS+ Programm
- Kommunikation und Hochschulkultur
- MeerCommunity Startup Center
-
Sustainability
- Ombudswesen
-
Personalabteilung
- Staff Council
- Präsidialbüro/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Computer Center
- Language Centre
- Studium Generale
- MyCampus
- [Translate to english:] Operating group ver.di
-
Wissens- und Technologietransfer
- Student Counselling Service
- Zentrum für Weiterbildung
- Karriere
- Administration
- Events
- Mission statement
- Organizational chart
- Figures, data and facts
-
Regulations, guidelines and announcements
- Regulations and rules
-
Ordnungen für Studiengänge
- Advanced Management
- Applied Life Sciences
- Betriebswirtschaft
- Betriebswirtschaft (dual)
- Biotechnologie/Bioinformatik
- Biotechnologie
- Biotechnologie im Praxisverbund
- Business Administration (dual)
- Business Intelligence and Data Analytics
- Business Management
- Business Management (Bachelor)
- Chemietechnik/Umwelttechnik
- Chemietechnik im Praxisverbund
- Digital Management
- Elektrotechnik
- Elektrotechnik im Praxisverbund
- Elektrotechnik und Automatisierungstechnik
- Energieeffizienz
- Energy and Sustainability Management
- Engineering Physics (Bachelor)
- Engineering Physics im Praxisverbund
- Engineering Physics (Master)
- Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
- Industrial Informatics
- Informatik
- Informatik im Praxisverbund
- Inklusive Frühpädagogik
- Interdisziplinäre Physiotherapie/Motologie/Ergotherapie
- International Business Administration
- Internationaler Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (IBS)
- International Business and Culture
- Kindheitspädagogik
- Lasertechnik
- Management Consulting
- Maritime Operations
- Maritime Technology and Shipping Management
- Maschinenbau
- Maschinenbau und Design
- Maschinenbau und Design für Berufsqualifizierte
- Maschinenbau und Design im Praxisverbund
- Medientechnik
- Nachhaltige Produktentwicklung im Maschinenbau
- Nachhaltige Prozesstechnologie
- Nachhaltige Prozesstechnologie im Praxisverbund
- Nautik
- Nautik und Seeverkehr
- Online-Bachelorstudiengang Medieninformatik (Voll-/Teilzeit)
- Online-Masterstudiengang Medieninformatik (Voll-/Teilzeit)
- Online-Bachelorstudiengang Regenerative Energien
- Online-Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (Voll-/Teilzeit)
- Online-Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik
- Physiotherapie
- Schiffs- und Reedereimanagement
- Soziale Arbeit
- Soziale Arbeit (BASA-online)
- Soziale Arbeit und Gesundheit im Kontext sozialer Kohäsion (Vollzeit/Teilzeit)
- Soziale Kohäsion im Kontext Sozialer Arbeit u. Gesundheit
- Sozial- und Gesundheitsmanagement
- Sozialmanagement
- Sustainable Energy Systems
- Technical Management
- Technology of Circular Economy
- Wirtschaftsinformatik (Dual)
- Wirtschaftsingenieurwesen Maritime Wissenschaften (B.Sc.)
- Wirtschaftsingenieurwesen - Engineering & Management
- Wirtschaftspsychologie
- Verkündungsblätter
- Committees
- University representatives
- University elections
-
Departments A-Z
- Study locations
-
Research
-
Focuses
- Research strategy
- Forschungsschwerpunkte
-
Forschende
- Seefahrt und Maritime Wissenschaften
- Soziale Arbeit und Gesundheit
-
Wirtschaft
- Prof. Dr. Knut Henkel
- Prof. Dr. Tom Koch
- Prof Dr. Ute Gündling
- Prof Dr. Annika Wolf
- Prof. Dr. Jan Handzlik
- Prof. Dr. Hans-Gert Vogel
- Prof. Dr. Till Becker
- Prof. Dr. Henning Hummels
- Prof. Dr. Thomas Lenz
- Prof. Dr. Wolfgang Portisch
- Prof. Dr. Jan Christopher Pries
- Prof. Dr. Ute Rademacher
- Prof. Dr. Marco Rimkus
- Prof. Dr. Eva-Maria Schön
- Prof. Dr. Joachim Schwarz
- Technik - Elektrotechnik + Informatik
- Technik - Maschinenbau
-
Technik - Naturwissenschaftliche Technik
- Prof. Dr. Gerhard Illing
- Prof. Dr. Gottfried Walker
- Prof. Dr. Ingo de Vries
- Prof. Dr. Mark Rüsch gen. Klaas
- Prof. Dr. Jens Hüppmeier
- Prof. Dr. Iván Herráez
- Prof. Dr. Ralf Habermann
- Dr. Julia Jessica Reimer
- Prof. Dr. Claudia Gallert
- Prof. Dr.-Ing. Philipp Huke
- Prof. Dr. Martin Silies
- Prof. Dr. Martin Sohn
- Prof. Dr. Sven Steinigeweg
- Prof. Dr. habil. Ulrich Teubner
- Folgeabschätzung und Ethik
-
Projects
-
Aktuelle Forschungsprojekte
- Applied Sustainable Transformation by Regional Anchors
- Adaptive Fortbildungen in der medienpädagogischen Altenbi
- AnkerPROF
- BUFFER+
- EARLY
- Entwicklung eines Reinigungsroboters für Offshore-WKA
- ExStyrol
- FlettnerFLEET
- GE-VORS
- Hyper4Rail
- INDUZELL
- InnoWerft
- Integrierte und innovative maritime Technologien für Mobi
- ISE-FiT Nordwerst
- MIINTER
- MeerCommunity
- NESSIE
- Nordwest Niedersachsen Nachhaltig Neu (4N)
- PANTHER
- ProlOg
- ReqET
- SIoT-Gateway
- SoGeWi
- SoWeKi
- StaKiNd
- Standardisierung, Weiterentwicklung und Kommunikation von
- Transferzentrum für Nachhaltige Mobilität
- TwinMaP
- VOLAP
- Wind & Regio
- W4S - Wind4Shipping
- WaddenVision
- KUNO
- Projekte nach Bereichen
- Beendete Projekte
-
Aktuelle Forschungsprojekte
-
Research institutes
- Promotionskollegien
-
Institute
-
Netzwerke
- Nationalpark Wattenmeer
- Promotionsnetzwerk Emden/Leer
- Digital Hub Ostfriesland (DHO)
- Tötungshandlungen in Einrichtungen des Gesundheitswesens
- Wachstumsregion Emsachse
- Maritimes Kompetenzzentrum (Mariko)
- greentech Ostfriesland
- NorShiP-Research School
- Association of Schools of Public Health
- Hochschulen für Gesundheit
- Deutsche Gesellschaft für Public Health
- Powerhouse Nord
- GENDERnet
- Einrichtungen in den Fachbereichen
-
Advice
-
Focuses
News Fachbereichs Seefahrt & Maritime Wissenschaften
Abschlussveranstaltung des Forschungsprojektes „ROBUST“ in Leer
Mehr als fünf Jahre lang hat sich ein Forschungsteam des Hochschulinstituts für Logistik (HILOG) an der Hochschule Emden/Leer in Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück, der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH), der Universität Bremen und dem Deutschen Wetterdienst mit der Frage beschäftigt, welches Einsparpotenzial sich beim Einsatz so genannter Windzusatzantriebe auf Seeschiffen ergibt. Die Ergebnisse wurden am Montag bei der Abschlussveranstaltung des Projektes im Maritimen Kompetenzzentrum (MARIKO) in Leer präsentiert und diskutiert.
Seit Jahrtausenden hat der Mensch den Wind als Antrieb auf Schiffen benutzt. Erst seit einem guten Jahrhundert hat der Motorantrieb mit dem günstigen Öl als Brennstoff den Windantrieb weitgehend verdrängt. Mit dem steigenden Ölpreis und mit den Erkenntnissen über die Umweltbelastung durch die Emissionen aus der Verbrennung wurde der Windantrieb wieder aktuell. Dies betraf nicht nur die Stromerzeugung durch die Windräder, sondern auch die Seeschifffahrt.
Ein Windzusatzantrieb ist eine Art Hybridantrieb, bei dem die Maschinenleistung des Schiffs mit einem alternativen Windantrieb, etwa durch ein Segel, unterstützt wird. Als Zusatzantriebe wurden der Flettner-Rotor, der auch auf dem E-Ship 1 der Firma Enercon zum Einsatz kommt, ein modifiziertes Rahsegel, das Dynarigg, und der Kite betrachtet. Um das Einsparpotenzial auf verschiedenen Routen wetterabhängig errechnen zu können, wurde das Verhalten des Schiffs in Wind und Wellen mit mathematischen Modellen simuliert. Bestandteil der entwickelten Software ist auch ein Routenoptimierungsmodul, das in Abhängigkeit der vorherrschenden Wetterbedingungen die energiesparendste Strecke ermittelt. Zur Überprüfung dieser Modelle hatte das Forschungsteam auf einem Frachter der Leeraner Reederei Briese diverse Messgeräte installiert, mit deren Hilfe zwei Jahre lang Daten gesammelt und mit den Simulationsergebnissen verglichen wurden.
Wie sich herausstellte, können beispielsweise auf der Route Nordamerika-Deutschland bei einer Schiffsgeschwindigkeit von 13 Knoten wetterabhängig rund 15 bis 35 Prozent an Energiekosten eingespart werden. „Da die Treibstoffkosten - entgegen dem Trend der vergangenen Jahre - derzeit auf einem sehr niedrigen Stand sind, rechnen sich Windzusatzantriebe momentan allerdings nicht“, zog Prof. Dr. Michael Schlaak vom Projektteam der Hochschule Emden/Leer Bilanz. Die im Projekt entwickelte Software ermögliche es jedoch, auch für Schiffe ohne Windzusatzantrieb eine energetisch günstige Route bei der aktuellen Wettersituation zu errechnen, wie Dr. Stephan Kotzur, Leiter des ausführenden Hochschul-Instituts für Logistik (HILOG) betonte. Er dankte allen Beteiligten für ihre Mitarbeit in den vergangenen fünf Jahren, darunter auch dem Initiator des Projekts, Prof. Reinhard Elsner.
Neben den Projektmitarbeitern waren am Montag auch Vertreter der Partnerfirmen ins MARIKO gekommen, um vor dem Hintergrund der Ergebnisse über aktuelle Entwicklungen, Wirtschaftlichkeit und Effizienz zu sprechen. Das Projekt zeige die hohe wissenschaftliche Forschungskapazität der Hochschule Emden/Leer, wie Prof. Jens Froese von der TUHH sagte. Dies werde auch durch die Tatsache belegt, dass zwei Dissertationen im Rahmen des Projektes realisiert werden.
Related News
- 09/12/2024 Internationale Studierende als Chance für die Region
- 08/30/2024 Friesenhügel wird zur Rennpiste
- 08/13/2024 Mit Chaos im Kopf neue Umweltlösungen finden
- 07/31/2024 Hochschule Emden/Leer tritt dem AHOI MINT Cluster NordWest bei und begeistert junge Menschen für MINT-Themen
- 07/12/2024 Mit Herz und Know-how nachhaltige Entwicklung fördern